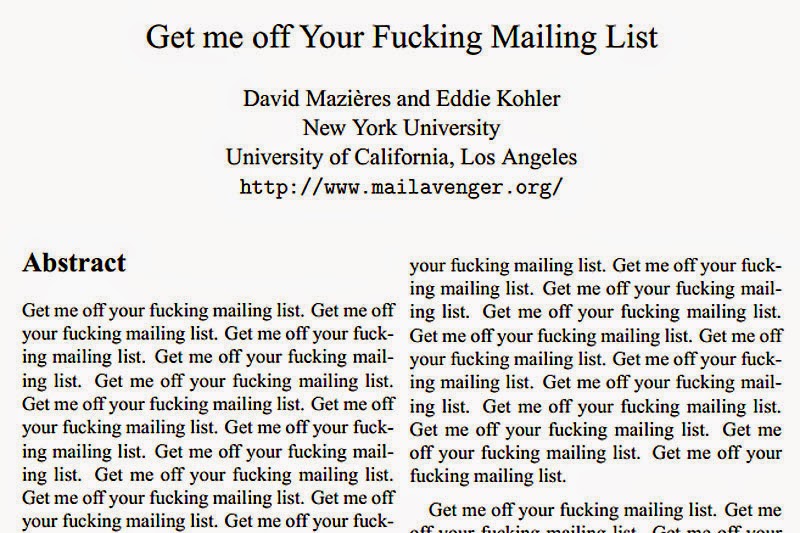aus nzz.ch, 2.12.2014, 08:04 Uhr
Alkoholkonsum im Tierreich
Als Menschenaffen sich auf alkoholisierte Früchte spezialisierten
Eine Mutation in einem Enzym ermöglicht es Menschenaffen vor 10 Millionen Jahren, Alkohol schneller abzubauen. Von da an können sie gärende Früchte in grossen Mengen verzehren.
von Lena Stallmach
Tiere sind dem Alkohol nicht abgeneigt. Darauf lassen unzählige anekdotische Berichte schliessen. Bekanntheit erlangte eine Szene aus dem Dokumentarfilm «Die lustige Welt der Tiere» aus dem Jahr 1974, in der Elefanten, Giraffen und Affen herumtorkeln, nachdem sie sich mit überreifen Früchten vollgefressen haben. Doch ist der Rauschzustand für Tiere gefährlich. Durch ihre Unachtsamkeit und fehlende Koordination sind sie für Räuber eine leichte Beute. Auch für Menschen ist übermässiger Alkoholkonsum schädlich. Dennoch können viele nicht die Finger davon lassen. Forscher grübeln darüber, wie sich ein so negatives Verhalten in der Evolution halten konnte.
Alkohol weist auf Zucker hin
Laut einer Theorie konsumieren Affen schon seit Millionen von Jahren regelmässig Alkohol in gärenden Früchten. Dabei ist der Geruch von Alkohol ein Indikator für süsse, kalorienreiche Früchte – also etwas Positives. Nun haben Forscher um Matthew Carrigan vom Santa Fe College in Gainsville, Florida,weitere Hinweise gefunden, die diese Theorie stützen.¹
Sie zeigen, dass Menschenaffen vor etwa zehn Millionen Jahren die Fähigkeit entwickelten, Alkohol schneller abzubauen. Die Forscher verglichen die Gensequenzen eines Alkohol abbauenden Enzyms (ADH4) verschiedener Primaten- und Säugetierarten. Sie stellten die Enzyme im Labor her und zeigten, dass jene Variante, die bei Gorillas, Schimpansen und Menschen vorliegt, Alkohol vierzigmal schneller abbaut als die Variante des Orang-Utans, der ebenfalls zu den Menschenaffen gehört.
Nachdem sich die Linie der Menschenaffen getrennt hatte, hat der gemeinsame Vorfahre von Gorilla, Schimpanse und Mensch demnach vor etwa zehn Millionen Jahren durch eine einzige Mutation in ADH4 die Fähigkeit erworben, grössere Mengen gegorener Früchte zu verspeisen. Diese Anpassung fällt laut den Forschern in einen Zeitraum, in dem sich das Klima in Afrika veränderte.
Mit Folgen für den Lebensraum der Primaten: Das waldreiche Ökosystem wurde durch fragmentierte Wald- und Graslandschaften ersetzt. Viele Arten starben aus, andere passten sich an. Während die frühen Menschenaffen wie die heutigen Orang-Utans auf Bäumen lebten, verlagerten sich die Vorfahren von Gorilla, Schimpanse* und Mensch auf den Boden. Dort also, wo gärende Früchte häufiger zu finden sind als in Bäumen. Die Forscher nehmen an, dass die Mutation für die Tiere zur rechten Zeit kam, um diese Nahrungsquelle optimal zu nutzen.
Ein evolutionäres Hangover
Als der Mensch dann aber vor etwa 9000 Jahren die Fähigkeit erlangte, alkoholische Getränke zu brauen, kamen die negativen Folgen des Alkoholkonsums zum Tragen. Die positive Bewertung von kalorienreicher Nahrung entpuppt sich in der modernen Welt ebenfalls als Nachteil. In diesem Zusammenhang spricht man von einem evolutionären Hangover. Alle unsere genetischen Marker seien noch darauf getrimmt, dass kalorienreiche Nahrung gut für uns sei, erklärt der Suchtforscher Rainer Spanagel vom Institut für Seelische Gesundheit in Mannheim.
In der neuen Studie sieht Spanagel die Theorie des evolutionären Hangover erneut bestätigt. Im Jahr 2008 hatte er mit Kollegen gezeigt, dass Federschwanz-Spitzhörnchen für ihre kleine Körpergrösse grosse Mengen Alkohol konsumieren.² Dennoch fielen die Tiere nie durch Trunkenheit auf. Später habe sich gezeigt, dass bei ihnen ein anderes Alkohol abbauendes Enzym sehr effizient arbeite: zehnmal schneller als beim Menschen, sagt Spanagel. Womöglich hatte der Alkohol bei ihnen also keine psychoaktive Wirkung. Wenn die Tiere aber wählen durften zwischen einem künstlich hergestellten Palmnektar mit oder ohne Alkohol, entschieden sie sich häufiger für den alkoholischen. Auch dies könne man damit erklären, dass sie Alkohol mit kalorienreicher Nahrung gleichsetzten, sagt Spanagel.
¹ PNAS, Online-Publikation vom 1. Dezember 2014; ² PNAS 105, 10426–10431 (2008).
*) Hier wird anscheinend davon ausgegangen, dass Schimpansen und Gorillas erst später wieder (teilweise) auf die Bäume zurückkehrten. JE
Nota.- Ich versuch's mal mit reiner weniger biologischen als menschenkundigen Erklärung: Nachdem die Menschen sich erst einmal den Geist zugezogen hatten, war Nüchternheit auf die Dauer kein zufrieden- stellender Zustand.
JE
Dienstag, 2. Dezember 2014
Montag, 1. Dezember 2014
Falscher Objektivismus in der Psychiatrie.
aus Die Presse, Wien, 01.12.2014 | 21:01 |
Psychische Leiden
Mehr Information über Ursachen schwächt Empathie
Die Versachlichung psychischer Leiden durch Wissenschaft – Genetik, Hirnforschung – kann Patienten auf Maschinen reduzieren.
Irrenhäuser gibt es nicht mehr, zumindest heißen sie nicht mehr so, und „verrückt“ wird keiner mehr genannt, in dessen Gehirn etwas durcheinandergeht. Das hat seinen guten Grund: Niemand wird mehr aus der Menschheit hinausdefiniert – etwa als besessen, von Dämonen oder gar vom Teufel –, psychische Krankheiten gelten als Krankheiten wie körperliche auch, die Medizin dringt in ihre molekularen Feinheiten ein, vor allem mit Genetik und Hirnforschung. Aber diese Versachlichung hat einen paradoxen Preis: Wieder droht ein Hinausdefiniertwerden aus der Menschheit, als schlecht funktionierende Apparate diesmal: Die Leiden werden – in der Wahrnehmung – nicht wegemotionalisiert, sondern wegneutralisiert.
Und zwar just in der Wahrnehmung derer, die den Leidenden professionell helfen wollen und sollen, in der der Psychologen und Psychiater: Methew Lebowitz (Yale) hat 237 in den USA um Therapievorschläge für vier fiktive Patienten gebeten, es ging um Schizophrenie, Sozialphobie, Depression und Zwangsstörung. Die waren zudem in zwei Gruppen unterteilt, in der einen wurde das Leiden strikt biologisch beschrieben – genetisch und neurobiologisch –, in der anderen psychosozial, da ging es um Lebensgeschichten, etwa erlebte elterliche Gewalt. – Dann legte man den Probanden eine Liste mit 18 Wörtern vor, die sie den Patienten zuordnen sollten, die aber mehr über sie sagten: Sechs hatten mit Einfühlungsvermögen zu tun, Empathie („warm“, „sympathisch“ etc.), sechs mit Stress („aufgeregt“, „durcheinander“ etc.), die restlichen dienten der Kontrolle („ärgerlich“, „glücklich“). Nun zeigte die Art der Beschreibung ihre Macht: Bei Patienten/Leiden, die in biologische Termini gefasst waren, war die Empathie der Spezialisten geringer, und die Empfehlung von rein biologischen Gegenmitteln – Medikamenten statt Gesprächstherapien – höher (Ausnahme: Schizophrenie: Die galt durchgehend als biologisch verursacht und therapierbar).
Neue Form der Dehumanisierung
Natürlich war das Design des Experiments übertrieben – kein Seelenarzt beurteilt einen Patienten nur nach biologischen oder lebensgeschichtlichen Faktoren –, deshalb ging es in der zweiten Runde realistischer zu: Die Krankenblätter enthielten beide Aspekte, unterschiedlich gewichtet. Der Effekt zeigte sich neuerlich (Pnas, 1. 12.). „Biologische Erklärungen sind zweischneidige Schwerter“, schließt Lebowitz: „Sie können dehumanisieren, indem sie Menschen auf biologische Maschinen reduzieren.“ (jl)
Psychische Leiden
Mehr Information über Ursachen schwächt Empathie
Die Versachlichung psychischer Leiden durch Wissenschaft – Genetik, Hirnforschung – kann Patienten auf Maschinen reduzieren.
Irrenhäuser gibt es nicht mehr, zumindest heißen sie nicht mehr so, und „verrückt“ wird keiner mehr genannt, in dessen Gehirn etwas durcheinandergeht. Das hat seinen guten Grund: Niemand wird mehr aus der Menschheit hinausdefiniert – etwa als besessen, von Dämonen oder gar vom Teufel –, psychische Krankheiten gelten als Krankheiten wie körperliche auch, die Medizin dringt in ihre molekularen Feinheiten ein, vor allem mit Genetik und Hirnforschung. Aber diese Versachlichung hat einen paradoxen Preis: Wieder droht ein Hinausdefiniertwerden aus der Menschheit, als schlecht funktionierende Apparate diesmal: Die Leiden werden – in der Wahrnehmung – nicht wegemotionalisiert, sondern wegneutralisiert.
Und zwar just in der Wahrnehmung derer, die den Leidenden professionell helfen wollen und sollen, in der der Psychologen und Psychiater: Methew Lebowitz (Yale) hat 237 in den USA um Therapievorschläge für vier fiktive Patienten gebeten, es ging um Schizophrenie, Sozialphobie, Depression und Zwangsstörung. Die waren zudem in zwei Gruppen unterteilt, in der einen wurde das Leiden strikt biologisch beschrieben – genetisch und neurobiologisch –, in der anderen psychosozial, da ging es um Lebensgeschichten, etwa erlebte elterliche Gewalt. – Dann legte man den Probanden eine Liste mit 18 Wörtern vor, die sie den Patienten zuordnen sollten, die aber mehr über sie sagten: Sechs hatten mit Einfühlungsvermögen zu tun, Empathie („warm“, „sympathisch“ etc.), sechs mit Stress („aufgeregt“, „durcheinander“ etc.), die restlichen dienten der Kontrolle („ärgerlich“, „glücklich“). Nun zeigte die Art der Beschreibung ihre Macht: Bei Patienten/Leiden, die in biologische Termini gefasst waren, war die Empathie der Spezialisten geringer, und die Empfehlung von rein biologischen Gegenmitteln – Medikamenten statt Gesprächstherapien – höher (Ausnahme: Schizophrenie: Die galt durchgehend als biologisch verursacht und therapierbar).
Neue Form der Dehumanisierung
Natürlich war das Design des Experiments übertrieben – kein Seelenarzt beurteilt einen Patienten nur nach biologischen oder lebensgeschichtlichen Faktoren –, deshalb ging es in der zweiten Runde realistischer zu: Die Krankenblätter enthielten beide Aspekte, unterschiedlich gewichtet. Der Effekt zeigte sich neuerlich (Pnas, 1. 12.). „Biologische Erklärungen sind zweischneidige Schwerter“, schließt Lebowitz: „Sie können dehumanisieren, indem sie Menschen auf biologische Maschinen reduzieren.“ (jl)
Freitag, 28. November 2014
Wo dein Gedächtnis sitzt.
aus derStandard.at, 28. 11. 14
Hirnforscher lokalisieren Entstehungsort von Erinnerungen
Wissenschafter nutzten dafür besonders präzise Form der Magnetresonanz-Tomographie
Magdeburg - Das Gehirn nimmt ständig Informationen auf. Doch wie aus neuen Erlebnissen dauerhafte Erinnerungen entstehen, ist erst ansatzweise bekannt. Nun ist es einem internationalen Team unter der Federführung von Forschern der Universität Magdeburg und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) gelungen, den Entstehungsort von Erinnerungen mit bislang unerreichter Genauigkeit zu bestimmen. Die Neurowissenschafter konnten diesen Ort auf einzelne Schaltkreise des menschlichen Gehirns eingrenzen.
Hirnforscher lokalisieren Entstehungsort von Erinnerungen
Wissenschafter nutzten dafür besonders präzise Form der Magnetresonanz-Tomographie
Magdeburg - Das Gehirn nimmt ständig Informationen auf. Doch wie aus neuen Erlebnissen dauerhafte Erinnerungen entstehen, ist erst ansatzweise bekannt. Nun ist es einem internationalen Team unter der Federführung von Forschern der Universität Magdeburg und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) gelungen, den Entstehungsort von Erinnerungen mit bislang unerreichter Genauigkeit zu bestimmen. Die Neurowissenschafter konnten diesen Ort auf einzelne Schaltkreise des menschlichen Gehirns eingrenzen.
Für ihre Untersuchungen nutzten die Forscher eine besonders präzise Form der Magnetresonanz-Tomographie (MRT). Die Forscher hoffen, dass ihre Studienergebnisse, die im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlicht wurden, dazu beitragen könnten, besser zu verstehen, wie sich beispielsweise Alzheimer auf das Gedächtnis auswirkt.
Beim Gedächtnis wirken verschiedene Hirnbereiche zusammen. Heute weiß man, dass Erinnerungen hauptsächlich in der Hirnrinde gespeichert werden und sich die Schaltzentrale, die Gedächtnisinhalte erzeugt und auch wieder abruft, im Inneren des Gehirns befindet. Ort des Geschehens ist der sogenannte Hippocampus und der unmittelbar angrenzende Entorhinale Cortex. "Schon länger ist bekannt, dass diese Hirnareale an der Gedächtnisbildung beteiligt sind. Hier fließen Informationen zusammen und werden verarbeitet. Unsere Studie hat den Blick auf diese Situation weiter verfeinert", erläutert Emrah Düzel vom DZNE in Magdeburg.
Informationsflüsse im Hippocampus
Die Forscher konnten innerhalb des Hippocampus und des Entorhinalen Cortex die Gedächtnisbildung bestimmten neuronalen Schichten zuordnen. Dabei beobachteten sie, welche neuronale Schicht aktiv war. Dies gewährt Rückschlüsse darauf, ob Information in den Hippocampus hineinfloss oder aus dem Hippocampus heraus in die Hirnrinde gelangte. Bisherige MRT-Verfahren waren nicht genau genug, um diese Richtungsinformation zu erfassen. Damit haben die Neurowissenschafter erstmals nachweisen können, wo sich im Gehirn sozusagen der Eingang zum Gedächtnis befindet.
Hippocampus
Hippocampus
Für die aktuelle Studie untersuchten die Wissenschafter die Gehirne von Probanden, die sich für einen Gedächtnistest zur Verfügung gestellt hatten. Die Forscher setzten dafür eine besondere Form der Magnetresonanz-Tomographie ein, die "Ultra-Hochfeld-MRT" bei 7 Tesla. Dadurch konnten sie die Aktivität einzelner Hirnregionen mit bislang unerreichter Genauigkeit erfassen.
Wie die Gedächtnisstörungen bei Alzheimer entstehen
Wie die Gedächtnisstörungen bei Alzheimer entstehen
"Mit dieser Messmethode können wir den Informationsfluss im Gehirn verfolgen und die Hirnbereiche, die an der Verarbeitung von Erinnerungen beteiligt sind, mit großer Detailtiefe untersuchen", so Düzel. "Davon erhoffen wir uns neue Erkenntnisse darüber, wie die für Alzheimer typischen Gedächtnisstörungen entstehen. Sind bei einer Demenz die Informationen an der Pforte zum Gedächtnis noch intakt? Setzt die Störung also erst bei der späteren Weiterverarbeitung im Gedächtnis ein? Das sind Fragen, die wir hoffen, beantworten zu können." (red,)
Abstract
Nature Communications: "Laminar activity in the hippocampus and entorhinal cortex related to novelty and episodic encoding"
Nature Communications: "Laminar activity in the hippocampus and entorhinal cortex related to novelty and episodic encoding"
Donnerstag, 27. November 2014
Entscheidungen fallen im präfrontalen Kortex.
.
Nathalie Huber
Kommunikation
Universität Zürich
Unsere Entscheidungen lassen sich im Gehirn abbilden. Welche Areale dabei am aktivsten sind, können Wissenschaftler der Universität Zürich in einer neuen Studie zeigen. Dabei ist offenbar der sogenannte präfrontale Kortex nicht nur erhöht aktiv bei Entscheidungen, die Selbstkontrolle erfordern, sondern generell bei der Entscheidungsfindung. Die Ergebnisse könnten für die Förderung von Entscheidungskompetenzen in schwierigen Situationen nützlich sein.
Der Wert eines Stücks Schokoladenkuchen ist veränderlich. Wer gerade auf Diät ist, entscheidet sich eher für das Fruchtdessert und bewertet den kalorienreichen Kuchen als ungesund. Bisherige Studien haben gezeigt, dass ein bestimmtes Netz im Gehirn aktiv ist, wenn man sich zwischen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten entscheiden muss, deren Wert je nach Kontext variiert. Sie heben dabei die Interaktion zwischen den Neuronen zweier Hirnregionen des präfrontalen Kortex’ hervor – der Kontrollinstanz des Gehirns an der Stirnseite.
Präfrontaler Kortex bei allen Entscheidungen erhöht aktiv
Sarah Rudorf und Todd Hare vom Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich können nun in ihrer neuen Studie jene Gehirnareale bestimmen, die während des Prozesses der Entscheidungsfindung am aktivsten sind. Ihre Ergebnisse weisen darauf hin, dass die neuronalen Interaktionen zwischen dem sogenannten dorsolateralen und ventromedialen präfrontalen Kortex nicht nur dann eine zentrale Rolle spielen, wenn zwischen mehreren Möglichkeiten abgewogen werden muss, sondern ganz allgemein für eine flexible Entscheidungsfindung ausschlaggebend sind. Dies widerspricht der Meinung, dass eine erhöhte Aktivität des präfrontalen Kortex’ nur dann auftritt, wenn Selbstbeherrschung verlangt ist, um zwischen gegensätzlichen Präferenzen entscheiden zu können.
Bisher wurden in den Experimenten nur Situationen betrachtet, in denen Personen gegensätzliche Wünsche in Einklang bringen müssen, um ein Ziel zu erreichen. Beispielsweise haben Probanden finanzielle Gewinne gegen Fairnessinteressen abzuwägen oder unmittelbare Gewinne gegen langfristige Auszahlungen. Sara Rudorf und Todd Hare fragten sich, was sich im Gehirn abspielt, wenn keine widersprüchlichen Wünsche gegeben sind und keine Selbstkontrolle verlangt wird.
Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler mittels funktioneller Magnetresonanztomographie die Gehirne von 28 Probanden, während dem diese Auswahlfragen beantworteten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich dabei für Handlungen entscheiden, die stets mit einem finanziellen Gewinn verbunden waren. Allerdings änderten sich im Verlauf der Untersuchung mehrmals die Regeln, wonach eine Handlung die grösste Auszahlung mit sich brachte.
«Entscheidungen, die Selbstbeherrschung verlangen, sind überaus wichtig, da sie das körperliche, gesellschaftliche und finanzielle Wohlergehen einer Person direkt beeinflussen», erklärt Sarah Rudorf. Dank der Bestimmung der Mechanismen im Gehirn, die nicht nur bei Entscheidungen, die Selbstbeherrschung verlangten, sondern auch bei generellen Entscheidungen zum Tragen kommen, könnten sich neue Anknüpfpunkte für Therapien auftun. «Man könnte Schulungsprogramme entwickeln, um bestimmte Entscheidungskompetenzen für schwierige Situationen zu fördern, in denen es auf Selbstbeherrschung ankommt», schliesst Todd Hare.
Literatur:
Sarah Rudorf und Todd Hare. Interactions between Dorsolateral and Ventromedial Prefrontal Cortex Underlie Context-Dependent Stimulus Valuation in Goal-Directed Choice.
Journal of Neuroscience, November 26, 2014, 34(48):15988 –15996.
Kontakt:
Prof. Todd Hare
Institut für Volkswirtschaftslehre
Universität Zürich
Tel. +41 44 634 10 17
E-Mail: todd.hare@econ.uzh.ch
Weitere Informationen: http://www.mediadesk.uzh.ch
Wie verschiedene Hirnareale bei Entscheidungen kooperieren
Kommunikation
Universität Zürich
Unsere Entscheidungen lassen sich im Gehirn abbilden. Welche Areale dabei am aktivsten sind, können Wissenschaftler der Universität Zürich in einer neuen Studie zeigen. Dabei ist offenbar der sogenannte präfrontale Kortex nicht nur erhöht aktiv bei Entscheidungen, die Selbstkontrolle erfordern, sondern generell bei der Entscheidungsfindung. Die Ergebnisse könnten für die Förderung von Entscheidungskompetenzen in schwierigen Situationen nützlich sein.
Der Wert eines Stücks Schokoladenkuchen ist veränderlich. Wer gerade auf Diät ist, entscheidet sich eher für das Fruchtdessert und bewertet den kalorienreichen Kuchen als ungesund. Bisherige Studien haben gezeigt, dass ein bestimmtes Netz im Gehirn aktiv ist, wenn man sich zwischen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten entscheiden muss, deren Wert je nach Kontext variiert. Sie heben dabei die Interaktion zwischen den Neuronen zweier Hirnregionen des präfrontalen Kortex’ hervor – der Kontrollinstanz des Gehirns an der Stirnseite.
Präfrontaler Kortex bei allen Entscheidungen erhöht aktiv
Sarah Rudorf und Todd Hare vom Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich können nun in ihrer neuen Studie jene Gehirnareale bestimmen, die während des Prozesses der Entscheidungsfindung am aktivsten sind. Ihre Ergebnisse weisen darauf hin, dass die neuronalen Interaktionen zwischen dem sogenannten dorsolateralen und ventromedialen präfrontalen Kortex nicht nur dann eine zentrale Rolle spielen, wenn zwischen mehreren Möglichkeiten abgewogen werden muss, sondern ganz allgemein für eine flexible Entscheidungsfindung ausschlaggebend sind. Dies widerspricht der Meinung, dass eine erhöhte Aktivität des präfrontalen Kortex’ nur dann auftritt, wenn Selbstbeherrschung verlangt ist, um zwischen gegensätzlichen Präferenzen entscheiden zu können.
Bisher wurden in den Experimenten nur Situationen betrachtet, in denen Personen gegensätzliche Wünsche in Einklang bringen müssen, um ein Ziel zu erreichen. Beispielsweise haben Probanden finanzielle Gewinne gegen Fairnessinteressen abzuwägen oder unmittelbare Gewinne gegen langfristige Auszahlungen. Sara Rudorf und Todd Hare fragten sich, was sich im Gehirn abspielt, wenn keine widersprüchlichen Wünsche gegeben sind und keine Selbstkontrolle verlangt wird.
Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler mittels funktioneller Magnetresonanztomographie die Gehirne von 28 Probanden, während dem diese Auswahlfragen beantworteten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich dabei für Handlungen entscheiden, die stets mit einem finanziellen Gewinn verbunden waren. Allerdings änderten sich im Verlauf der Untersuchung mehrmals die Regeln, wonach eine Handlung die grösste Auszahlung mit sich brachte.
«Entscheidungen, die Selbstbeherrschung verlangen, sind überaus wichtig, da sie das körperliche, gesellschaftliche und finanzielle Wohlergehen einer Person direkt beeinflussen», erklärt Sarah Rudorf. Dank der Bestimmung der Mechanismen im Gehirn, die nicht nur bei Entscheidungen, die Selbstbeherrschung verlangten, sondern auch bei generellen Entscheidungen zum Tragen kommen, könnten sich neue Anknüpfpunkte für Therapien auftun. «Man könnte Schulungsprogramme entwickeln, um bestimmte Entscheidungskompetenzen für schwierige Situationen zu fördern, in denen es auf Selbstbeherrschung ankommt», schliesst Todd Hare.
Literatur:
Sarah Rudorf und Todd Hare. Interactions between Dorsolateral and Ventromedial Prefrontal Cortex Underlie Context-Dependent Stimulus Valuation in Goal-Directed Choice.
Journal of Neuroscience, November 26, 2014, 34(48):15988 –15996.
Kontakt:
Prof. Todd Hare
Institut für Volkswirtschaftslehre
Universität Zürich
Tel. +41 44 634 10 17
E-Mail: todd.hare@econ.uzh.ch
Weitere Informationen: http://www.mediadesk.uzh.ch
Dienstag, 25. November 2014
Get me off Your Mailng List.
aus derStandard.at, 24. November 2014, 15:26
Wie "Get me off Your Fucking Mailing List" zum "Fachartikel" wurde
Magazin akzeptiert einen Anti-Spam-Brief, der nur aus einem einzigen Satz besteht, als "exzellent"
Der Begriff "Predatory open access publishing" bezeichnet im Englischen ein unseriöses Geschäftsmodell, in dem vermeintliche Fachjournale - gegen eine Gebühr für den Autor, versteht sich - Artikel veröffentlichen, ohne diese dem branchenüblichen Peer-Review-Verfahren zu unterziehen. Das weitgehende bis vollständige Fehlen von Kontrolle kann im Extremfall dazu führen, dass auch vollkommener Nonsens veröffentlicht wird. Über ein besonders schönes Beispiel dafür berichtet der Blog io9.com.
Die Form gewahrt
Ein Merkmal solcher Journale ist, dass sie aggressiv Werbung betreiben und ihre erhoffte Akademiker-Kundschaft mit der Aufforderung, bei ihnen zu publizieren, zuspammen. Selbiges tun auch Konferenzen der weniger seriösen Art, und der Einladung zu einer solchen Konferenz antworteten im Jahr 2005 die beiden US-Computerwissenschafter David Mazières und Eddie Kohler in origineller Weise:
Sie verfassten ein"Paper", das formal absolut korrekt gegliedert ist, aber nur aus einem einzigen Satz in vielfacher Wiederholung besteht: "Get me off Your Fucking Mailing List", dazwischen eingestreut ein einsames "Introduction" und ein "Summary". Sogar zwei Infografiken sind enthalten, genauer gesagt grafische Umsetzungen der Worte - erraten - "Get me off Your Fucking Mailing List".
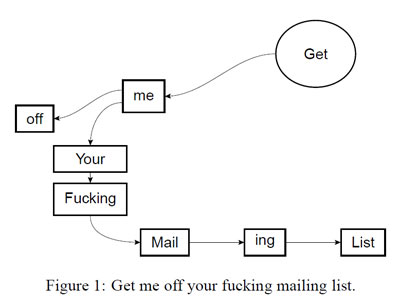
Vor Kurzem hat dieser Anti-Spam-Brief ein unerwartetes zweites Leben verliehen bekommen und es mittlerweile nicht nur in die Schlagzeilen, sondern sogar schon zu einem eigenen Wikipedia-Eintrag gebracht. Der australische IT-Wissenschafter Peter Vamplew erinnerte sich nämlich an den Brief von Mazières und Kohler, als er vom Pseudo-Fachmagazin "International Journal of Advanced Computer Technology" angemailt wurde. Er leitete den Text ohne weiteren Kommentar an das Journal weiter und dachte sich, man würde dort seine Botschaft schon verstehen.
Wie "Get me off Your Fucking Mailing List" zum "Fachartikel" wurde
Magazin akzeptiert einen Anti-Spam-Brief, der nur aus einem einzigen Satz besteht, als "exzellent"
Der Begriff "Predatory open access publishing" bezeichnet im Englischen ein unseriöses Geschäftsmodell, in dem vermeintliche Fachjournale - gegen eine Gebühr für den Autor, versteht sich - Artikel veröffentlichen, ohne diese dem branchenüblichen Peer-Review-Verfahren zu unterziehen. Das weitgehende bis vollständige Fehlen von Kontrolle kann im Extremfall dazu führen, dass auch vollkommener Nonsens veröffentlicht wird. Über ein besonders schönes Beispiel dafür berichtet der Blog io9.com.
Die Form gewahrt
Ein Merkmal solcher Journale ist, dass sie aggressiv Werbung betreiben und ihre erhoffte Akademiker-Kundschaft mit der Aufforderung, bei ihnen zu publizieren, zuspammen. Selbiges tun auch Konferenzen der weniger seriösen Art, und der Einladung zu einer solchen Konferenz antworteten im Jahr 2005 die beiden US-Computerwissenschafter David Mazières und Eddie Kohler in origineller Weise:
Sie verfassten ein"Paper", das formal absolut korrekt gegliedert ist, aber nur aus einem einzigen Satz in vielfacher Wiederholung besteht: "Get me off Your Fucking Mailing List", dazwischen eingestreut ein einsames "Introduction" und ein "Summary". Sogar zwei Infografiken sind enthalten, genauer gesagt grafische Umsetzungen der Worte - erraten - "Get me off Your Fucking Mailing List".
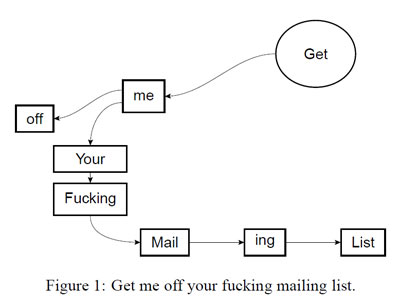
grafik: mazières und kohler
Vor Kurzem hat dieser Anti-Spam-Brief ein unerwartetes zweites Leben verliehen bekommen und es mittlerweile nicht nur in die Schlagzeilen, sondern sogar schon zu einem eigenen Wikipedia-Eintrag gebracht. Der australische IT-Wissenschafter Peter Vamplew erinnerte sich nämlich an den Brief von Mazières und Kohler, als er vom Pseudo-Fachmagazin "International Journal of Advanced Computer Technology" angemailt wurde. Er leitete den Text ohne weiteren Kommentar an das Journal weiter und dachte sich, man würde dort seine Botschaft schon verstehen.
Womit er nicht gerechnet hatte, war die Antwort: Der Text wurde vom "International Journal of Advanced Computer Technology" als Artikel akzeptiert. Er wäre sogar veröffentlicht worden, hätte Vamplew die geforderte Gebühr bezahlt.
Und wer sagt, dass es bei diesen Journalen keine Peer Review gäbe? Jeffrey Beall von der Universität Colorado, ein bekannter Kritiker unseriöser Open-Access-Journale, veröffentlichte auf "Scholarly Open Access" das Antwortschreiben des Journals. Darin wurde dem Paper von einem nicht genannten "Experten" bescheinigt, dass es sich "exzellent" zur Veröffentlichung eigne ...
(jdo)
Montag, 24. November 2014
Innere Uhr und soziale Zeit.
Wolfgang Müller M.A.
AWMF Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
11.11.2014 13:08
Köln. Die Auswirkungen von unzureichendem und nicht erholsamem Schlaf auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen ist das Hauptthema der 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Dabei ergeben sich immer wieder Beziehungen zur Chronotypologie des Menschen, zur Prägung des Menschen durch seine innere Uhr.
Einer der bekanntesten Forscher auf dem Gebiet der Chronobiologie in Deutschland ist Prof. Till Roenneberg vom Institut für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im folgenden Interview plädiert Prof. Roenneberg u.a. für flexible Arbeitszeitmodelle, Verständnis für die Bedürfnisse von Schülern und mehr Respekt vorm Schlaf.
- Professor Roenneberg, kommt unser Schlaf denn im Alltag zu kurz?
Unter der Arbeitswoche auf jeden Fall. Die inneren Uhren der meisten Menschen in Industrieländern gehen nach, weil wir ihnen zu wenig Kontrast zwischen Tageslicht und Dunkelheit geben. Wir halten uns fast nur noch in Gebäuden auf, wo die Lichtintensität bis zu tausendmal schwächer ist als tagsüber unter freiem Himmel. Nach Sonnenuntergang setzen wir uns dann immer noch künstlichem Licht aus. Wir leben also in einer Dauerdämmerung. Unter diesen Umständen hinkt unsere innere Uhr hinterher, so dass wir zwar immer später einschlafen können, aber immer noch zu traditionell frühen Zeiten zur Arbeit gehen müssen. Wir sind also an Arbeitstagen immer mehr auf Wecker angewiesen und schlafen immer weniger, und versuchen an freien Tagen unseren Schlafmangel wieder auszugleichen.
- Sie haben den Begriff des „sozialen Jetlag“ geprägt, also der Divergenz unserer inneren Uhr von sozialen Alltagsstrukturen. Wie kann dieser überwunden werden?
Schuld am sozialen Jetlag ist vor allem unser Lichtverhalten. Als wir noch vorwiegend draußen gearbeitet haben und nachts kein elektrisches Licht anzünden konnten, war unsere Innenzeit mit der Außenzeit, mit den sozialen Zeitstrukturen im Einklang. Wir erwachten morgens früh von alleine und schliefen abends früh genug ein, um unser Schlafsoll zu erfüllen. Heute stimmt unsere Innenzeit nicht mehr mit der sozialen Zeit überein, die Innenzeit wird immer später und die soziale Zeit bleibt relativ konstant. Dem sozialen Jetlag können wir mit zwei Maßnahmen entgegenwirken: Einmal sollten wir die Arbeitszeiten auf allen Ebenen und in allen Sparten unserer Wirtschaft flexibilisieren, so dass die Menschen wieder in dem von der inneren Uhr vorgegebenen Zeitfenster schlafen können und keinen Wecker brauchen. Dann müssen sie auch nicht die Hälfte ihrer arbeitsfreien Tage verschlafen, um das arbeitswöchentliche Defizit auszugleichen.
Zum anderen sollte die Architektur und die Lichtindustrie wieder viel (blauhaltiges) Tageslicht vom Dach in die Räume „spiegeln“ (große Fenster sind dafür nicht genug und eine elektrische Lösung ist zu teuer und umweltschädlich). Die künstliche Beleuchtung muss intelligent dynamisch sein. Das heißt, sie muss nach Sonnenuntergang die Blaulichtanteile aus der Beleuchtung nehmen, ohne unsere Sehleistung zu schwächen. Das sind sicherlich schwierige Aufgaben, ich bin aber optimistisch, dass diese Fortschritte machbar sind.
- Welches sind für Sie die vielversprechendsten chronobiologischen Forschungen im Moment?
Das Wunderbare an der Chronobiologie ist ihre Vielseitigkeit und Interdisziplinarität – von der Molekularbiologie und der Metabolismus-Forschung bis zur Arbeitsmedizin und Kognitionsforschung. Auf der molekularen Ebene entdecken Chronobiologen gerade biochemische Uhrwerke in der Zelle, die wahrscheinlich in der Evolution viel früher entstanden sind als die genetischen Uhrwerke, die Ende des letzten Jahrhunderts als erstes entdeckt wurden. Auf der physiologisch-medizinischen Ebene bringt die Chronobiologie erste Erkenntnisse ans Licht wie die innere Uhr mit dem Stoffwechsel zusammenarbeitet und wie sie an der Entstehung von Krankheiten beteiligt ist. Auf der arbeitsmedizinischen Ebene beginnen wir langsam zu verstehen, wie wir Arbeitszeiten individuell anpassen können, so dass selbst Schichtarbeit weniger gesundheitsschädlich werden könnte. Es sind spannende Zeiten in der chronobiologischen Forschung.
- Auf dem Jahreskongress der DGSM werden Sie über das „Human Sleep Project“ berichten. Womit beschäftigt sich dieses Projekt und welche ersten Ergebnisse konnten Sie verzeichnen?
Wir haben in der Chronobiologie die Erfahrung gemacht, dass man unglaublich viel lernen kann, wenn man die Forschung aus dem Labor in den Alltag trägt. Dies hat sich das „Human Sleep Project“ (HSP) nun auch für die Erforschung des Schlafs zur Aufgabe gemacht. Obwohl wir teilweise die biochemischen und neuronalen Prozesse, die Schlaf initiieren, steuern und aufrecht erhalten bis ins Detail kennen, haben wir immer noch keine Antworten auf die einfachsten Fragen. Wie viel Schlaf braucht denn ein Individuum oder wie kann man denn Schlafqualität im Alltag objektiv messen, sind Beispiele für solche grundlegenden Fragen. Im HSP wollen wir den Schlaf im Kontext, das heißt im individuellen Alltag über viele Wochen in Tausenden von Menschen messen. Hierfür müssen zahlreiche neue Methoden entwickelt werden, die dieses ambitionierte Ziel möglich machen. Prinzipiell steht eine Internet-Plattform im Zentrum des HSP über die jeder Interessierte seine Daten hochladen kann (z.B. Aufzeichnungen der Bewegungsaktivität) und dann eine circadiane und eine Schlafanalyse erhalten. So wird das HSP eine umfassende Datenbank anlegen, die wissenschaftlich genutzt werden kann, und die Teilnehmer können ihr Verhalten analysieren, verstehen und eventuell zu ihren Gunsten ändern. Die ersten Erfolge der Methodenentwicklung und die ersten Ergebnisse einer solchen Datenbank werden Inhalt meines Vortrags auf dem DGSM-Kongress sein.
- Sie plädieren dafür, dass zumindest für Oberstufenschüler die Schule eine Stunde später beginnen soll und dass Arbeitgeber offen sein sollten für einen flexiblen Beginn ihrer Beschäftigten je nach deren Chronotyp. Ließe sich das gesellschaftlich durchsetzen?
Ebenso wie ich für eine Flexibilisierung am Arbeitsplatz bin, plädiere ich dafür, dass die Schulzeiten auf die biologischen Bedürfnisse von Jugendlichen eingehen – die inneren Uhren von 14 bis 21 Jährigen gehören zu den spätesten in der Bevölkerung (aus biologischen Gründen!). Ziel eines späteren Schulbeginns ist eine Verbesserung der Lernsituation von Jugendlichen. Spättypen erreichen nachweislich schlechtere Abiturnoten als Frühtypen. Dieser Diskrimination muss ein Ende gesetzt werden. Außerdem kann sich ein Land, dessen einziger Rohstoff in den Gehirnen der Menschen und damit in ihrer Ausbildung liegt, keine Mängel in der Lehr- und Lernwelt erlauben. Diese Welten müssen daher auch zeitlich optimiert werden und zwar vor allem für die Lernenden und nicht so sehr für die Lehrenden. Ich schlage seit Jahren in Deutschland vor, mit ausgewählten Schulen Pilotprojekte durchzuführen und wissenschaftlich zu begleiten. Leider ist es dazu nie gekommen. Meine Kollegen in England führen nun solche Versuche in großem Stil an vielen Schulen durch. Dabei wäre es hierzulande viel wichtiger – in England beginnen die meisten Schulen nämlich erst um 9.00 Uhr!
- Wie könnte man die besondere Gefährdung von Schicht- und Nachtarbeitern verbessern?
Indem man bei der Schichtplanung auf den Chronotyp des einzelnen Arbeitnehmers eingeht und indem man genaue Messungen macht, welche Rotationspläne für welchen Menschen (Spät- und Frühtyp, jung und alt) am geeignetsten sind. Beides wird derzeit intensiv erforscht und wird potentiell die Gefährdung von Schichtarbeitern drastisch verringern. Wichtig sind dabei aber auch rechtliche und gesellschaftliche Veränderungen. Sonderzuschläge sollten nicht mehr nur für die Nachtschichten bezahlt werden, sondern einfach und allein für die Forderung des Arbeitgebers in Schichten zu arbeiten. Nur wenn die alleinigen finanziellen Anreize für die Nachtschichten wegfallen, lassen sich gesundheitsförderliche Schichtpläne durchsetzten. Außerdem sollten Mittel und Wege gefunden werden, die wenigstens in der Industrie Arbeiten zwischen drei und sechs Uhr unnötig machen. Diese Maßnahmen werden die Situation von Schichtarbeitern mit Sicherheit verbessern.
- Welche Forderungen stellen Sie hinsichtlich der Berücksichtigung von chronobiologischen Aspekten im Lebens- und Arbeitsrhythmus der Menschen an Politik und Gesellschaft?
Mehr Flexibilität, mehr Toleranz, Fördermaßnahmen für neue Lichtarchitektur. Mehr Respekt vor dem Schlaf, der dem Wachsein nichts nimmt sondern ihm zuträgt.
- Noch eine letzte Frage: Können aus ihrer Sicht die neuen Apps oder iHealth Tracker irgendetwas zu einer besseren Schlafqualität beitragen?
Im Zuge des Ausbruchs der Forschung aus dem Versuchslabor in die reale Welt – in den alltäglichen Kontext – helfen alle Selbst-Mess-Geräte. Nur sind oft die Methoden, die diese Geräte verwenden, um Schlaf zu analysieren weder transparent noch wissenschaftlich validiert. Beides gehört zu den Aufgaben des Human Sleep Projekts. Diagnosen des individuellen Schlafverhaltens sollten nur akademisch ausgebildete Fachkräfte geben, mit Hilfe von transparenten und validierten Methoden. Das heißt, die vielen Geräte sind hervorragend, die Auswertung der gesammelten Daten sollte man unabhängigen Spezialisten überlassen. Die Daten-Plattform des Human Sleep Projects wird dafür die notwendigen Voraussetzungen schaffen.
Prof. Till Roenneberg hält auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) am 5. Dezember 2014 um 9 Uhr im Congresssaal I+II des Congresscentrum Ost Koelnmesse in Köln einen Vortrag mit dem Titel „The Human Sleep Project – Rahmen, Ziele und erste Ergebnisse“. Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen!
Kontakt für Rückfragen: Conventus Congressmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Romy Held, Tel.: 03641/3116280, romy.held@conventus.de
Samstag, 22. November 2014
Nicht im Wasser, sondern in der Erdkruste.
Das Leben begann in der Erdkruste
Beate Kostka M.A.
Ressort Presse - Stabsstelle des Rektorats
Universität Duisburg-Essen
Wo und wie entstand auf unserem blauen Planeten das Leben? In der Erdkruste, behaupten der Geologe Prof. Dr. Ulrich Schreiber und der Physikochemiker Prof. Dr. Christian Mayer von der Universität Duisburg-Essen (UDE), und können das auch beweisen. Ihre aufsehenerregende These macht gerade in Expertenkreisen Furore.
Worum geht es? Was auf der jungen Erde vor mehr als 30 Millionen Jahren los war, lässt sich heute nur sehr schwer rekonstruieren. Erst recht, welche Bedingungen für die Entstehung von Leben vorherrschten. Wissenschaftler beschränkten sich deshalb bislang eher auf eng begrenzte Aussagen zu einzelnen Reaktionen. Als möglicher Ort für das Aufkommen erster organischer Materie wurden alle möglichen Lokalitäten auf der Erdoberfläche diskutiert: von der Tiefsee bis hin zu flachen Tümpeln. In letzter Zeit wurden mangels plausibler Alternativen sogar außerirdische Regionen, wie der Mars oder der Weltraum insgesamt, als Lösung vorgeschlagen.
Vernachlässigt wurde dagegen der Bereich der Erdkruste. Eigentlich unlogisch, denn genau hier, in den tiefreichenden tektonischen Störungszonen mit Kontakt zum Erdmantel, sind die Verhältnisse optimal, so Prof. Schreiber. Von dort steigen Wasser, Kohlendioxid und andere Gase auf, wie heute noch in der Eifel. Sie enthalten alle erforderlichen Stoffe, die man für organisch-biologische Moleküle benötigt. Und mit ihnen begann das Leben.
Das überzeugendste Argument, dass es in der Erdkruste losging, ist das Kohlendioxid. Denn ab einer Tiefe von etwa 800 Metern wird es zugleich flüssig und gasförmig („überkritisch“). Mayer: „Mit diesem besonderen Zustand können wir viele Reaktionen erklären, die im Wasser nicht funktionieren. Kohlendioxid wirkt dann nämlich wie ein organisches Lösungsmittel und erweitert die Zahl der möglichen chemischen Reaktionen erheblich.“ Darüber hinaus bildet es mit Wasser Grenzflächen, die schrittweise zu einer Doppelschicht-Membran führen, das wichtigste Strukturelement der lebenden Zelle.
Neu ist, so Prof. Mayer, dass das UDE-Modell den Entstehungsprozess umfassend beschreibt und mehrere Probleme löst: die Molekülherkunft, die Aufkonzentrierung, die Energieversorgung und die Membranbildung. Im Labor ließen sich bereits diese grundlegenden Schritte auf dem Weg zu einer Zelle nachweisen: Seien es erste zellähnliche Strukturen oder die Entstehung komplexer Moleküle wie Proteine und Enzyme. „Besonders attraktiv für das Erklärungsmodell ist zudem die Tatsache, dass diese Entstehungsbedingungen schon in bestimmten Gesteinen aus der Frühzeit der Erde nachgewiesen werden konnten“, so Chemieprof. Oliver Schmitz.
In winzigen Flüssigkeitseinschlüssen, wie sie in uralten australischen Gangquarzen vorkommen, fanden die Wissenschaftler eine Vielzahl organischer Stoffe aus der Frühzeit der Erde. Weil sie während der Kristallbildung eingeschlossen wurden, haben sie sich bis heute erhalten. Sie helfen dabei, die Ergebnisse der Laborversuche mit der Wirklichkeit abzugleichen.
Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430
Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/geologie/forschung/origin.shtml
Abonnieren
Posts (Atom)




.jpg)