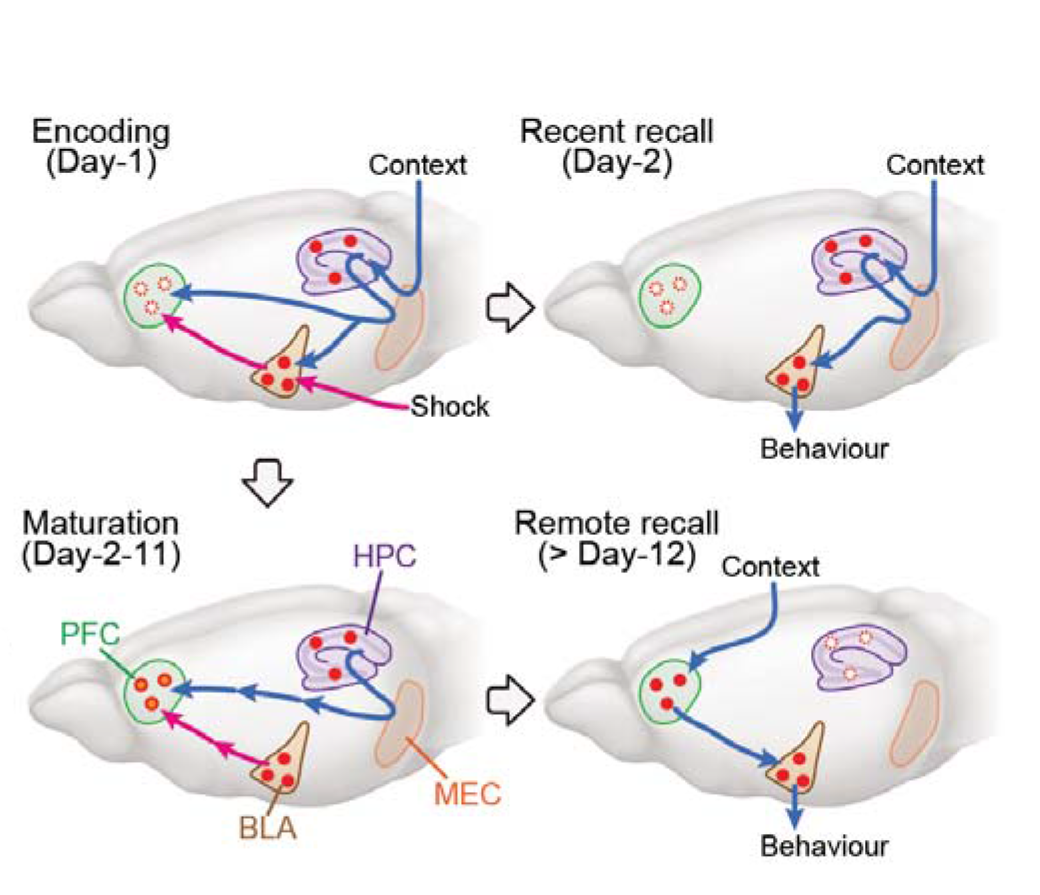Tagträumen: Von wegen Fehler im System
Gedankliche Auszeiten sorgen für eine bessere Vernetzung des Gehirns
Mehr als nur loses Gedanken-Wirrwarr: Tagträume gelten gemeinhin als störende mentale Aussetzer. Doch solche Auszeiten haben auch etwas Positives. Denn wer seinen Gedanken regelmäßig bewusst freien Lauf lässt, bei dem arbeiten bestimmte Hirnregionen, die für die kognitive Kontrolle zuständig sind, besser zusammen. Tagträumen ist demnach alles andere als ein unkontrollierter Prozess - sondern kann im Gegenteil sogar beim Lösen von Problemen helfen.
Wer kennt das nicht: Am Schreibtisch im Büro sinnieren wir über den bevorstehenden Urlaub, planen auf dem Heimweg gedanklich schon das Wochenende durch oder grübeln beim Autofahren plötzlich darüber nach, ob wir wirklich die Haustür abgeschlossen haben. Immer wieder schweifen wir im Alltag mit unseren Gedanken von der Situation im Hier und Jetzt ab.
Passiert das in Momenten, die eigentlich unsere volle Aufmerksamkeit fordern, kann das gravierende Folgen haben - zum Beispiel im Straßenverkehr. Tagträumen gilt deshalb oft als Aussetzer in unserem kognitiven Kontrollsystem: ein Fehler im System, durch den wir für kurze Zeit nicht mehr Herr der Lage sind.
Bewusste Auszeit
Doch Tagträumen muss nicht immer etwas Störendes sein. Wissenschaftler sehen inzwischen auch die positiven Seiten des Phänomens. Diese treten vor allem dann zu Tage, wenn wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, unseren Gedanken nachzuhängen anstatt ungewollt und spontan abzuschweifen.
- Träumen und spielen.
- Neues über Träume.
- Lösungen im Traum vorausahnen.
- Im Traum sehen wir Bilder.
- Bewusst sein und die Sprache der Bilder.
- Klarträume und Selbstreflexion.
So haben Verhaltensstudien unter anderem gezeigt, dass absichtliche Tagträume manchen Menschen dabei helfen können, ihre Gedanken zu ordnen. Ein Forscherteam um Johannes Golchert vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hat nun herausgefunden, dass sich diese vorteilhaften Effekte gedanklicher Auszeiten sogar im Gehirn nachweisen lassen.
Stärkere Vernetzung
Für ihre Untersuchung befragten Golchert und seine Kollegen ihre Probanden zunächst zu ihrem tagträumerischen Verhalten. Dabei sollten diese selbst einschätzen, wie stark Aussagen wie: "Es passiert mir häufig, dass meine Gedanken spontan abdriften" oder: "Ich erlaube mir, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen" auf sie zutreffen. Mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) untersuchten die Wissenschaftler anschließend die Hirnstruktur der Studienteilnehmer.
Die Auswertung offenbarte einen deutlichen Zusammenhang: "Wir haben herausgefunden, dass bei Menschen, die häufig gewollt mit ihren Gedanken abschweifen, der Cortex in bestimmten Regionen im Stirnbereich des Gehirns dicker ausgebildet ist", berichtet Golchert.
Außerdem waren bei diesen Probanden zwei wichtige Netzwerke im Gehirn stärker vernetzt: das sogenannte Default-Mode Netzwerk, das besonders aktiv ist, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen, auf Informationen aus unserem Gedächtnis richten und das sogenannte fronto-parietale Kontrollnetzwerk, das als Teil unseres kognitiven Kontrollsystems unseren Fokus stabilisiert und etwa irrelevante Reize hemmt.
Kontrolle bleibt
Insbesondere diese stärkere Verknüpfung ist es, die das Tagträumen zu einem sinnvollen Prozess macht, glauben die Forscher. Denn durch die ausgeprägte Vernetzung könne das Kontrollnetzwerk stärker auf lose Gedanken einwirken und ihnen so eine stabilere Richtung geben. Das sei der Beleg dafür, dass unsere geistige Kontrolle im Falle des gezielten Tagträumens keineswegs aussetze, so das Team.
"Unser Gehirn scheint hier kaum einen Unterschied darin zu machen, ob unsere Aufmerksamkeit nach außen auf unsere Umgebung oder nach innen auf unsere Gedanken gerichtet ist. In beiden Fällen ist das Kontrollnetzwerk eingebunden", sagt Golchert. Die Folge: Auch beim Tagträumen können wir konzentriert über zukünftige Ereignisse nachdenken oder sogar wichtige Probleme lösen.
"Tagträume sollten also nicht nur als etwas Störendes betrachtet werden", so Golcherts Fazit. "Kann man sie gut kontrollieren, sie also unterdrücken, wenn es wichtig ist, und ihnen freien Lauf lassen, wenn es möglich ist, kann man den größtmöglichen Nutzen aus ihnen ziehen." (Neuroimage, 2017; doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.11.025)
(Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig, 13.04.2017 - DAL)