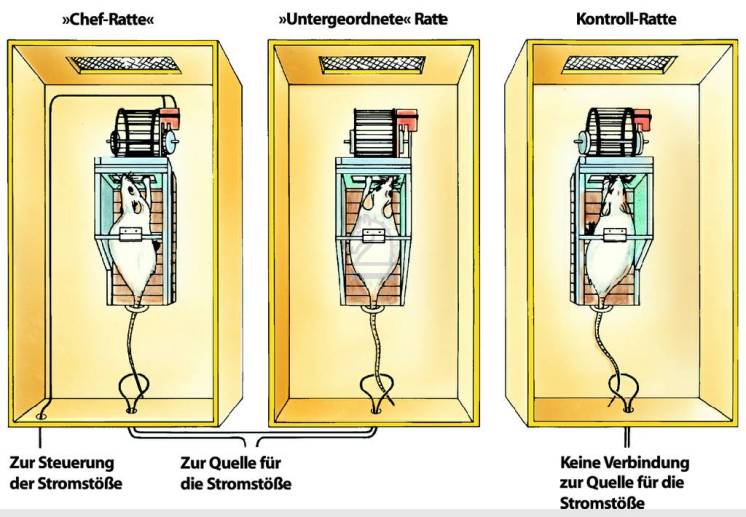Lamarck
Lamarck
aus Der Standard, Wien, 10.6.2015
"Epigenetische Vererbung findet überall statt"
Können umweltbedingte Veränderungen auch ohne DNA vererbt werden? Die israelische Evolutionsbiologin Eva Jablonka ist die wichtigste Befürworterin dieser Theorie
STANDARD: Seit gut zwanzig Jahren findet in der Biologie so etwas wie eine epigenetische Revolution statt: Forscher finden immer mehr Belege dafür, dass es jenseits der DNA und der Gene einen weiteren Code gibt, der an der Ausprägung unserer individuellen Merkmale beteiligt ist. Sehr viel umstrittener allerdings ist, ob es auch so etwas wie eine epigenetische Vererbung dieser Ausprägungen gibt. Sehe ich das richtig?
Jablonka: Ja. Was sich im Moment rund um die Epigenetik abspielt, ist in der Tat extrem spannend. Dass es alle möglichen epigenetischen Mechanismen gibt, steht längst völlig außer Zweifel. Umso heißer wird dagegen darüber gestritten, ob epigenetische Faktoren auch Auswirkungen auf die Vererbung und damit auch auf die Evolution haben.
STANDARD: Dies Forschungen haben eine lange Tradition - ohne dass man damals von Epigenetik sprach. Der Biologe Paul Kammerer, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien forschte, war einer der wichtigsten und letzten Vertreter einer solchen Vererbung erworbener Eigenschaften. Mit dem Selbstmord Kammerers im Jahr 1926 nach einem bis heute ungeklärten Fälschungsskandal schien diese Theorie aber erledigt. Inwiefern unterscheidet sich die Debatte heute von damals?
Jablonka: Der wichtigste Unterschied zwischen damals und heute besteht wohl darin, dass man damals nicht wusste, wie man sich das alles erklären kann. Man beobachtete schon damals Umwelteffekte, die über mehrere Generationen anhielten. Heute hingegen kennen wir alle möglichen epigenetischen Mechanismen, und wir wissen, wie das funktionieren kann - auch wenn wir noch lange nicht alle Details verstehen, wie sie vererbt werden. Heute kann niemand mehr sagen, dass es so etwas nicht gibt.
STANDARD: Erstaunlich ist, dass zwischen Kammerers Freitod 1926 und den letzten gut 20 Jahren der ganze Ansatz der Vererbung erworbener Eigenschaft in der westlichen Evolutionsbiologie ziemlich tabu war. Woran lag das?
Jablonka: Ich denke, dass die Politik da stark hineinspielte, konkret: der Kalte Krieg in der Biologie nach 1945. In der Sowjetunion wurden unter dem mächtigen Biologen Trofim Lyssenko Genetiker verfolgt, dessen Züchtungsexperimente mit Getreide sich zudem als Fälschung herausstellten. Es ist meines Erachtens sicher kein Zufall, dass es erst nach 1989, also unmittelbar nach dem Zerfall des kommunistischen Systems, in der Biologie zu einer Enttabuisierung epigenetischer Vererbung und einem Boom an Forschungen darüber kam.
STANDARD: Gibt es auch wissenschaftliche Gründe dafür?
Jablonka: Absolut. Eine Rolle spielte dabei sicher der Siegeszug der Entwicklungsbiologie. Dazu kamen die Fortschritte in der Gentechnik und die neuen Möglichkeiten, transgene Organismen herzustellen. Als die Biotechnologen damit begannen, fanden sie plötzlich sehr seltsame Phänomene: Die Gene verhielten sich nicht mehr so, wie man dachte, dass sie sich verhalten würden. So entdeckte man die sogenannte DNA-Methylierung, den bis heute wichtigsten epigenetischen Mechanismus. Entsprechend kamen die ersten soliden Daten über epigenetische Vererbung von Forschungen an transgenen Tieren und Pflanzen. Das waren auch meine Anfänge in der Forschung.
STANDARD: Aber Sie waren damals noch recht allein auf weiter Flur ...
Jablonka: Das stimmt. Ich hatte mich für die Vererbung erworbener Eigenschaften bereits interessiert, als ich mit 17 Jahren die Bücher von Arthur Koestler las, der damals als Nicht-Biologe für die Vererbung erworbener Eigenschaften argumentierte. Das war damals eine völlige Außenseiterposition, an der auch ich meine Zweifel bekam. Doch als ich mich dann einige Jahre später als Mikrobiologin mit Fragen der Epigenetik zu beschäftigen begann, wurde mir dann vieles plausibler.
STANDARD: Gerade in Sachen epigenetischer Vererbung scheinen aber auch noch heute nach wie vor viele Fragen offen zu sein.
Jablonka: Das stimmt. Es ist auch wirklich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Doch genau das macht auch die besondere Faszination dieser Forschungen aus. Mittlerweile gibt es aber Dutzende Studien, die verschiedene Mechanismen epigenetischer Vererbung bestätigen. Und ich würde sogar behaupten, dass epigenetische Vererbung überall stattfindet. Sie ist extrem verbreitet, aber eben schwer zu untersuchen, weil so viele Faktoren hineinspielen.
STANDARD: Eine der offenen Fragen ist, wie lange sie anhält.
Jablonka: Völlig richtig. Aber auch das hängt von vielen Faktoren ab: etwa davon, wie viele Generationen lang man Organismen bestimmten Umwelteinflüssen aussetzt. In Pflanzen hat man erst kürzlich epigenetische Effekte festgestellt, die über mehr als 30 Generationen anhalten. Die epigenetischen Mutationen sind zwar etwa fünf Mal so hoch wie in der DNA. Damit sind sie aber immer noch niedrig genug, dass sie der Selektion unterworfen werden.
STANDARD: Welche Konsequenzen hat das für die Evolutionsbiologie?
Jablonka: Wenn man das alles ernst nimmt, dann sind die radikal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in 50 Jahren peinlich berührt sein wird, wenn man sich evolutionsbiologische Lehrbücher aus dem Jahr 2015 ansieht.
STANDARD: Sie werden am Freitag bei Ihrem Vortrag in Wien aber zurückblicken und auch über die Forschungen an der Biologischen Versuchsanstalt vor 100 Jahren im Licht heutiger epigenetischer Erkenntnisse sprechen. Kann man wissenschaftlich noch etwas lernen, sich diese damaligen Forschungen anzuschauen?
Jablonka: Ich denke schon. Wir sollten jedenfalls versuchen, einige dieser Experimente zu wiederholen und uns ihre molekularbiologischen Grundlagen anschauen. Da sind zweifellos noch etliche Schätze zu heben, denn heute wissen wir, nach welchen epigenetischen Mechanismen wir suchen müssen - und wir haben die Werkzeuge, sie zu finden.
Eva Jablonka, 1952 in Polen geboren, lebt seit 1957 in Israel. Die studierte Biologin ist Professorin am Cohn Institut für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie der Universität Tel Aviv und veröffentlichte unter anderem mit Marion Lamb einige Standardwerke zur epigenetischen Vererbung.