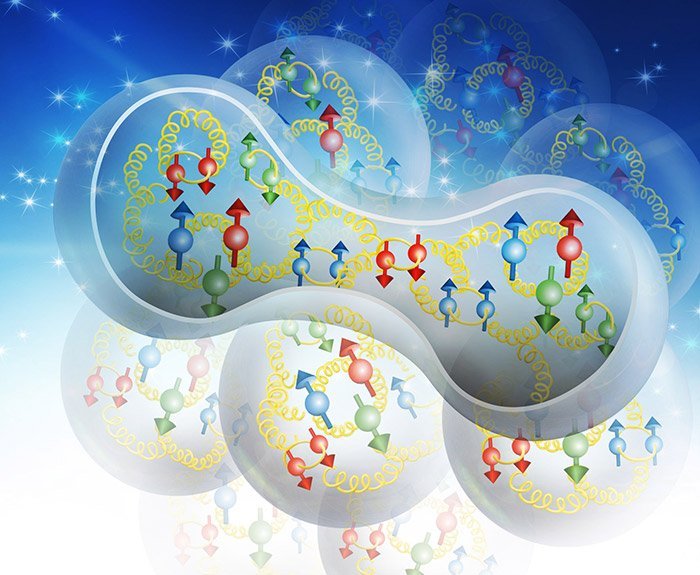Aus für analoge Quantentheorie
Niels Bohr und Louis de Broglie deuteten die Quantenphysik völlig unterschiedlich. Nun hat sich einer von beiden durchgesetzt - ausgerechnet dank Niels Bohrs Enkel.
Von Natalie Wolchover
2005 entdeckte ein Student im Labor des Strömungsphysikers Yves Couder in Paris per Zufall etwas Ver- blüffendes: Wenn winzige Öltropfen auf die Oberfläche eines vibrierenden Ölbades fallen, versinken sie nicht im Bad, sondern prallen daran ab. Anschließend hüpfen sie wie kleine Kaninchen auf der Flüssigkeit herum. Wie Couder feststellte, »surfen« die Tröpfchen sogar auf ihrer eigenen Welle: Beim Aufprall auf der Oberfläche schubsen sie die Welle an, und beim Abprallen an den Wellenbergen bewegen sie sich voran.
Als er die surfenden Tropfen beobachtete, erkannte Couder, dass sie eine frühe, weitgehend vergessene Vision der Quantenwelt zu verkörpern schienen: die des französischen Physikers Louis de Broglie. Vor einem Jahrhundert hatte dieser sich geweigert, auf ein klassisches Verständnis des Mikrokosmos zu ver- zichten. Dabei legten Experimente zu jener Zeit bereits nahe, dass die Realität im Quantenmaßstab nicht so ist, wie sie uns im Alltag scheint. Die damals vom dänischen Physiker Niels Bohr ins Leben gerufene »Kopenhagener Interpretation« der Quantenmechanik erklärte vielmehr, dass Dinge auf der Quantenskala erst dann »real« werden, wenn man sie beobachtet.
De Broglies Hadern mit der Wellenfunktion
Tatsächliche Gegebenheiten wie etwa der Aufenthaltsort eines Teilchens sind demnach bloß ein Produkt des Zufalls. Sie werden durch eine ausgedehnte Welle definiert, aus der sich mit den Methoden der Mathematik die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ergebnisse ablesen lässt. Erst im Moment der Messung kollabiert die Welle auf mysteriöse Weise auf einen Punkt, an den dann das Teilchen springt.
In den 1920er Jahren überzeugte Bohr die meisten seiner Zeitgenossen von dieser probabilistischen Sichtweise auf das Universum. Mit ihr geht eine Unschärfe einher, die der Natur innewohnt, sowie die rätselhafte Dualität von Welle und Teilchen, von der man heute bereits in der Schule hört.
Aber einige Physiker wandten sich gegen diese Interpretation, darunter neben de Broglie auch Albert Einstein. Einstein bezweifelte, dass Gott »würfelt«. De Broglie bestand darauf, dass alles im Quanten- maßstab mit unserer Vorstellung der Wirklichkeit übereinstimmt und sich keine wesentlichen Informa- tionen hinter der für uns einsehbaren Realität verbergen. Er entwickelte eine Version der Quantentheorie, die sowohl die Wellen- als auch die Teilchenaspekte von Licht, Elektronen und allem anderen in diesem Sinne behandelte.
Seine Theorie sah konkrete Partikel vor, die stets eine klar definierte Position im Raum haben und die von so genannten Pilotwellen durch den Raum geführt werden – ähnlich wie die Wellen, welche 2005 die hüpfenden Tröpfchen von Yves Couder über die Oberfläche des Ölbads in Paris antrieben.
Das Rätsel der Pilotwellen
De Broglie konnte jedoch die physikalische Natur der Pilotwellen nicht erfassen, und er kämpfte damit, sein Konzept auf mehr als ein Partikel auszudehnen. Auf der berühmten Solvay-Konferenz 1927, auf der die Physiker-Koryphäen die Bedeutung der Quantenmechanik diskutierten, setzten sich Bohrs radikalere Ansichten durch.
De Broglies Pilotwellen-Theorie geriet danach in Vergessenheit. Erst 78 Jahre später entwickelten die Pariser Physiker um Couder mit ihrem Öltröpfchenexperiment ein »analoges System«, mit dem sich die Idee testen ließ. Dabei stellten die Forscher verblüfft fest, dass die Tröpfchen überraschend quantenartige Verhaltensweisen an den Tag legten. Zum Beispiel durchquerten sie nur bestimmte, »quantisierte« Bahnen, die um das Zentrum der Flüssigkeitsbäder verliefen. Und manchmal sprangen die Tröpfchen zufällig zwischen den Bahnen hin und her, so ähnlich, wie es Elektronen in Atomen tun.
Bald entstanden auch anderswo Labore, in denen Tröpfchen hin und her sprangen, etwa am Massachusetts Institute of Technology. Dort konnten Forscher dann sogar beobachten, wie das Öl durch Barrieren tunnelte und andere Kunststücke vollführte, die zuvor nur für Quanten denkbar waren. Für einige Physiker kehrte damit de Broglies alter Traum zurück: eine Quantenwelt, die von Pilotwellen und -partikeln anstelle von rätselhaften Wahrscheinlichkeitswellen beschrieben wird.
Aber eine Reihe neuer Ergebnisse, die seit dem Jahr 2015 aufgetaucht sind, machen den Traum nun zunichte. Diese Experimente deuten darauf hin, dass Couders markanteste Demonstration quantenähnlicher Phänomene in Öltröpfchen aus dem Jahr 2006 fehlerhaft ist. Wiederholungen des Experiments, eine Variante des berühmten Doppelspaltexperiments, stehen explizit im Widerspruch zu den ersten Ergebnissen von Couder. Sie zeigen sogar, wie das Doppelspaltexperiment sowohl die mutmaßlichen Quanten-Öltröpfchen als auch de Broglies Pilotwellen-Theorie zu Fall bringt.
Niels Bohrs Enkel und die Theorie seines Großvaters
Wahrscheinlich ist ausgerechnet Niels Bohrs Enkel die Person, die de Broglies Idee den größten Schaden zugefügt hat. Der Strömungsphysiker Tomas Bohr ist Professor an der Technischen Universität Dänemark. Als Kind grübelte er gerne über den Rätseln, welche die Arbeit seines Großvaters aufgeworfen hatte.
Video direkt anschauen auf Youtube:
Tomas Bohr über das Doppelspaltexperiment mit Öltröpfchen
Vor sieben Jahren hörte er dann von Couders hüpfenden Tropfen und war gleich fasziniert. »Ich interessierte mich sofort brennend dafür, ob man wirklich eine deterministische Quantenmechanik entwickeln kann«, sagt er über seine Entscheidung, in dieses Forschungsfeld zu gehen. Angesichts seiner Familiengeschichte fügt er hinzu: »Vielleicht fühlte ich mich auch verpflichtet. Ich dachte, ich sollte wirklich versuchen festzustellen, ob es wahr ist oder nicht.«
Das Herz der Quantenmechanik
Der Physiker Richard Feynman sagte einst über das Doppelspaltexperiment: »Es ist unmöglich, absolut unmöglich, es auf irgendeine klassische Art und Weise zu erklären.« Für Feynman steckte »das Herz der Quantenmechanik« in dem Experiment, es sei geradezu das »einzige Geheimnis«, aus dem alles Weitere folgt.
In dem berühmten Experiment werden Partikel in Richtung einer Barriere mit zwei Schlitzen geschossen. Diejenigen Teilchen, die durch einen Spalt gelangen, treffen auf der anderen Seite der Barriere auf einen in einigem Abstand platzierten Bildschirm mit Sensoren. Wo ein Partikel einen Sensor trifft, ist jedes Mal überraschend. Aber wenn man viele Partikel in Richtung der Schlitze schießt, bilden sich nach und nach vertikale Streifen an einigen Punkten auf dem Schirm.
Das gilt gemeinhin als Hinweis, dass sich jedes Teilchen tatsächlich wie eine Welle verhält. Denn dann würde man erwarten, dass an den Schlitzen in der Barriere zwei Wellenfronten entstehen, die sich dahinter überlagern. Und an einigen Stellen addieren sich die Amplituden der Wellen, an anderen löschen sie die Welle aus. Oder in der Sprache der Teilchen: Teilchen können den Sensor nur an den Scheitelpunkten der Kopenhagener Wahrscheinlichkeitswelle treffen.
Noch seltsamer: Wenn man einen zweiten Sensor hinzufügt und misst, welchen Schlitz jedes Teilchen durchläuft, verschwinden die Interferenzstreifen – als ob die Wahrscheinlichkeitswelle zusammenge- brochen wäre. Diesmal laufen die Partikel direkt durch die Schlitze zu einem der beiden für sie erreich- baren Punkte auf dem fernen Sensor. Die Teilchen verhalten sich also nicht mehr wie Wellen, sondern wie kleine Kügelchen, die man durch eine der Öffnungen schießt.
Um das Doppelspaltexperiment zu erklären, wird ein Anhänger der Kopenhagener Deutung auf die inhärente Quantenunsicherheit hinweisen. Er würde argumentieren, dass die Bahn jedes Teilchens nicht genau bekannt sein kann und daher nur probabilistisch durch eine Wellenfunktion definiert ist. Nachdem die Wellenfunktion, wie jede Welle, durch beide Schlitze gegangen ist, überlappen sich die beiden Wellenzüge auf der anderen Seite. Der Sensorschirm wählt dann eine einzelne Realität aus den verfügbaren Möglichkeiten aus, und die Wellenfunktion »kollabiert«. Heraus kommt ein Punkt auf dem Bildschirm. Das wirft jedoch jede Menge Fragen auf, sowohl wissenschaftliche als auch philosophische; Niels Bohr, der dazu neigte, Fragen mit mehr Fragen zu beantworten, begrüßte das.
Für de Broglie erforderte die Deutung des Doppelspaltexperiments hingegen keine abstrakte, geheimnisvoll zusammenbrechende Wellenfunktion. Stattdessen entwickelte der Franzose das Bild eines echten Teilchens, das auf einer realen Pilotwelle surft. Wie Treibholz läuft das Partikel durch den einen oder anderen Schlitz im Doppelspaltsieb, auch wenn die Pilotwelle beide Öffnungen passiert. Auf der anderen Seite des Schirms fliegt das Teilchen dann dorthin, wo die beiden Wellenfronten der Pilotwelle konstruktiv interferieren.
Moderne Tests der De-Broglie-Theorie
De Broglie hat nie wirklich Gleichungen hergeleitet, um dieses komplizierte Zusammenspiel von Welle, Teilchen und Spalt zu beschreiben. Das hielt Couder und seinen Mitarbeiter Emmanuel Fort jedoch nicht davon ab, seine Theorie mit den hüpfenden Öltröpfchen zu überprüfen. 2006 berichteten sie in den »Physical Review Letters« von ihren erstaunlichen Ergebnissen: Nachdem sie die Bahnen von 75 springenden Tröpfchen durch eine Doppelspaltbarriere aufgezeichnet hatten, meinten Couder und Fort grobe Streifen an den Endpositionen der Tröpfchen erkennen zu können – ein interferenzähnliches Muster, das so aussah, als ob es nur von der Pilotwelle stammen könnte. Die Doppelspaltinterferenz, von der es hieß, sie sei »unmöglich auf klassische Weise zu erklären«, schien also ganz deutlich zu Tage zu treten.
Der Fluiddynamiker John Bush baute daraufhin ein eigenes Tropfenlabor am MIT auf und begeisterte andere Forscher für die Sache. Tomas Bohr hörte Couder im Jahr 2011 über seine Ergebnisse sprechen und diskutierte die Experimente später ausführlich mit Bush. Für eigene Studien tat er sich mit dem Experimentalphysiker Anders Andersen zusammen. »Wir waren wirklich fasziniert«, sagt Andersen.
Von da an kam die Sache ins Rollen: Bohrs und Andersens Gruppe in Dänemark, Bushs Team am MIT und eines unter der Leitung des Quantenphysikers Herman Batelaan an der Universität von Nebraska machten sich daran, das Springende-Tropfen-Doppelspaltexperiment zu wiederholen. Sie perfektionierten ihre Versuchsaufbauten, beseitigten Luftströmungen und ließen schließlich Öltröpfchen auf Pilotwellen in Richtung zweier Schlitze hüpfen. Doch keiner sah das von Couder und Fort gemeldete interferenzähnliche Muster. Die Tröpfchen gingen in fast geraden Linien durch die Schlitze, und es bildeten sich keine Streifen auf dem Schirm.
Die spektakuläre Messung des französischen Paars, die de Broglie zu bestätigen schien, gilt damit als fehlerhaft. Vermutlich haben äußere Störungen, fehlerhafte Auswertungsmethoden und zu kleine Stichprobengrößen das Ergebnis verfälscht. »Das Doppelspaltexperiment ist für mich eine Enttäuschung«, erklärt Paul Milewski, der Leiter der Abteilung für mathematische Wissenschaften an der University of Bath.
MIT-Forscher Bush hat seine detaillierten Doppelspaltstudien 2017 veröffentlicht. Sie enthalten keinen Hinweis auf Interferenzen. Aber er glaubt nach wie vor, dass es möglich sein könnte, ein Interferenzmuster mit Pilotwellen zu erzeugen. Man müsse nur die richtige Kombination von Parametern finden, etwa die richtige Frequenz für das vibrierende Flüssigkeitsbad, vielleicht sollte man auch eine Schallquelle hinzuschalten, um Störungen auszugleichen.
Milewski teilt diese Hoffnung. In der Arbeit der dänischen Gruppe, die ebenfalls keine Spuren der Pilotwellen-Effekte nachweisen konnte, präsentierte Tomas Bohr jedoch ein Gedankenexperiment, das de Broglies Pilotwellenbild im Grunde vollständig in sich zusammenstürzen lässt. In dieser hypothetischen »Gedankenversion« des Doppelspaltexperiments müssen die Partikel, bevor sie an der geschlitzten Barriere ankommen, auf die eine oder andere Seite einer zentralen Trennwand gelangen, die senkrecht zum Schirm zwischen den Schlitzen verläuft. Für die Standarddeutung der Quantenmechanik kann diese Wand sehr lang sein, denn die Wellenfunktion, in der die möglichen Pfade eines Teilchens stecken, kann sich auf beiden Seiten der senkrechten Trennwand ausbreiten. Die beiden Wellenzüge durchlaufen die Schlitze unabhängig voneinander und interferieren schließlich.

Thomas Bohrs Variante des Doppelspalt-Experiments geht davon aus, dass man senkrecht zu den Spalten eine Trennwand einfügt. In der Kopenhagener Deutung bereitet sie keine Probleme, in der de-Broglie-Wellentheorie hingegen schon.
Aber in de Broglies Bild, und ebenso bei den springenden Tröpfchenversuchen, kann sich die treibende Kraft des gesamten Experiments – das Teilchen – nur auf einer Seite der Wand befinden. Dabei verliert es zwangsläufig den Kontakt mit der Pilotwelle auf der anderen Seite der senkrecht zum Schirm angebrachten Barriere. Ohne Kontakt zum Teilchen beziehungsweise Tropfen geht der Wellenfront jedoch rasch die Puste aus; sie kommt lange vor Erreichen des Schlitzes zum Erliegen.
Ein Interferenzmuster kann es dadurch nicht geben. Die dänischen Forscher haben diese Argumente mittlerweile mit Computersimulationen verifiziert. Wieso Bush trotzdem weiter mit hüpfenden Tröpfchen herumprobiert? »Ich mochte Gedankenexperimente nie«, sagt er. »Das Schöne an der Situation ist doch, dass wir echte Experimente durchführen können.«
Dennoch hebt das Gedankenexperiment mit der Trennwand das inhärente Problem der Idee von de Broglie hervor: In einer Quantenrealität, die durch lokale Wechselwirkungen zwischen einem Partikel und einer Pilotwelle angetrieben wird, verliert man die notwendige Symmetrie, die für Doppelspaltinterferenzen und andere nicht-lokale Quantenphänomene benötigt wird. Für beides wird eine ätherartige, nichtlokale Wellenfunktion benötigt, die auf beiden Seiten jeder Wand ungehindert laufen kann. Aber Pilotwellen gäben das schlicht nicht her, so Tomas Bohr: »Da eine der Seiten im Experiment ein Partikel hat und die andere nicht, kommt das einfach nicht hin. Man verletzt zwangsläufig eine sehr wichtige Symmetrie in der Quantenmechanik.«
Eine Frage des Geschmacks
Manche Experten sind der Meinung, dass die einfachste Version von de Broglies Theorie zwangsläufig scheitern musste. Bei der Beschreibung einzelner Partikel, die von Pilotwellen geleitet werden, hatte de Broglie nicht die Möglichkeit berücksichtigt, dass mehrere interagierende Partikel in der Quantenphysik miteinander »verschränkt« werden können. Sie lassen sich dann durch eine einzige gemeinsame nichtlokale Wellenfunktion beschreiben. Ihre Eigenschaften sind in diesem Fall auch korreliert, wenn die Partikel Lichtjahre voneinander entfernt sind.
Seit den 1970er Jahren zeigen Experimente mit verschränkten Photonen, dass dieses Phänomen real ist und die Quantenmechanik damit nicht an den lokalen Determinismus gebunden ist. De Broglies Theorie hat jedoch ein Problem: Eine Theorie von Vor-Ort-Wechselwirkungen zwischen einem Partikel und seiner Pilotwelle nimmt eine höchst seltsame Gestalt an, wenn man so mehr als ein Teilchen beschreiben will.
Das könnte Sie auch interessieren:
Bis zu seinem Tod im Jahr 1987 wies de Broglie derartige Kritik an seiner Theorie zurück. Er war der festen Überzeugung, dass echte Pilotwellen schon irgendwie zur Verschränkung fähig seien. Einige Physiker, die Hüpfende-Tröpfchen-Experimente durchführten, haben diesen Traum lange geteilt. Aber mit Pilotwellen, die nicht einmal Doppelspaltinterferenzen bei einzelnen Partikeln erzeugen können, bricht er in sich zusammen, ganz wie eine Wellenfunktion in der Kopenhagener Deutung.
Schon früh, im Jahr 1952, hatte de Broglie eine Art Kompromiss angeboten: eine Version seiner Theorie, die er zusammen mit dem Physiker David Bohm entwickelt hatte und die heute als bohmische Mechanik oder De-Broglie-Bohm-Theorie bekannt ist. In diesem Bild gibt es eine abstrakte Wellenfunktion, die sich durch den Raum erstreckt und ähnlich mysteriös ist wie die Kopenhagener Variante. Der Theorie zufolge bewegen sich darin aber reale Partikel – und nicht die Welle-Teilchen-Zwitter aus der Kopenhagener Deutung.
Beweise in den 1970er Jahren haben gezeigt, dass die De-Broglie-Bohm-Theorie damit genau die gleichen Vorhersagen macht wie die Standardquantenmechanik. Mit den handfesten Teilchen entstehen jedoch neue Herausforderungen, etwa die, wie und warum die Wellenfunktion an bestimmten Stellen mit physikalischen Partikeln verbunden ist. »Die Quantenmechanik kommt aus dieser Perspektive betrachtet nicht weniger seltsam daher«, sagt Tomas Bohr. Die meisten Physiker sehen das ähnlich. Dennoch ist es bis heute eine Frage des Geschmacks, welche Theorie man besser findet – die experimentellen Vorhersagen sind identisch.
Tomas Bohr führt die Gewissheit seines berühmten Großvaters, dass die Natur auf der Quantenskala zwangsläufig bizarr ist, übrigens auf Niels Bohrs wichtigste physikalische Forschung zurück: 1913 berechnete Bohr die Energieniveaus im Wasserstoffatom. Er erkannte, dass, wenn Elektronen zwischen den Umlaufbahnen springen und quantisierte Lichtpakete freisetzen, kein mechanisches Bild mehr Sinn ergibt. Beispielsweise ließen sich die Energieniveaus der Elektronen nicht mit ihrer Bahnbewegung um den Atomkern in Verbindung bringen. Selbst die Kausalität scheiterte, weil Elektronen scheinbar schon vor einem Sprung wissen, wo sie landen werden, und dadurch ein Photon der richtigen Energie abgeben. »Er hat vermutlich deutlicher als die meisten anderen gesehen, wie komisch das Ganze ist«, erläutert Tomas Bohr. »Anders als die meisten anderen Menschen war er philosophisch veranlagt und daher bereit zu akzeptieren, dass die Natur seltsam ist.«
In den vergangenen Jahren hat sich Tomas Bohr oft gefragt, was sein Großvater über die Springende-Tröpfchen-Versuche gesagt hätte. »Ich denke, er wäre sehr interessiert gewesen«, sagt der Physiker und fügt lachend hinzu: »Er hätte vermutlich viel schneller als ich gewusst, was man davon halten soll. Und wäre sicher begeistert gewesen, dass man solch ein System nachstellen kann – schließlich kommt es dem, wovon de Broglie sprach, schon sehr nahe.«
Von "Spektrum der Wissenschaft" übersetzte und redigierte Fassung des Artikels "Famous Experiment Dooms Alternative to Quantum Weirdness" aus "Quanta Magazine", einem inhaltlich unabhängigen Magazin der Simons Foundation, die sich die Verbreitung von Forschungsergebnissen aus Mathematik und den Naturwissenschaften zum Ziel gesetzt hat.
Nota. - Einen Kommentar mir zu verkneifen fällt mir nicht schwer; ich verstehe es ja nicht wirklich. Doch dass lineare Kausalität und Determination nicht retabliert werden müssen, glaube ich schon als Resümé fest- halten zu dürfen. Dass die Natur "seltsam ist", zeigt sich mit jedem Schritt, den man tiefer in sie eindringt.
Seltsam nämlich für unser aus natürlicher Auslese und Anpassung in der Mesosphäre, in der allein wir exi- stieren können, erwachsenen Vorstellung. Der Modus unseres Vorstellens ist der analoge, die bildhafte Wie- dergabe. Unser begriffliches Denken dagegen ist digital, indem es in unanschaulichen Symbolen verfährt und bloße Bedeutungen re-präsentieren kann. Wir können daher Dinge begreifen, sie wir uns doch nicht vorstel- len können.
JE