aus NZZ, 15. 1. 2014
Bibliothekar, Sprachwissenschafter, Kunsttheoretiker
Eine Wiederentdeckung - Carl Ludwig Fernows Leben in seinen Briefen
von Ludger Lütkehaus ·
Unter den Gelehrten der deutschen Spätaufklärung und den bedeutenden
Geistern der Weimarer Klassik ist er einer der bemerkenswertesten: Carl
Ludwig Fernow, der Ästhetik-Theoretiker des Klassizismus, Philosoph,
Kritiker, Porträtmaler und Zeichner, Sprachwissenschafter und
-didaktiker, Grammatologe, fast ein Jahrzehnt lang römischer
Kulturkorrespondent, in Weimar und Jena Gesprächspartner Schillers,
Goethes und Wielands, der ihn zu den «Fünf Grossen» von Weimar zählt,
und - last, but not least - loyaler Freund der Familie Schopenhauer, die
in ihm den nach dem Suizid des Vaters fehlenden Mentor findet. Zum 250.
Geburtstag Fernows hat der Wallstein-Verlag eine zweibändige, fast
1400 Seiten umfassende, vorzüglich kommentierte Edition der Briefe des
Gelehrten, verantwortet von Margrit Glaser und Harald Tausch, vorgelegt.
Fassbar wird in diesen Briefen und im Kommentar eine konturenscharfe
lebendige Gestalt.
Über die Alpen
Am 19. November 1763 wird Carl
Ludwig Fernow in eine arme pommersche Gutsknechtsfamilie in Blumenhagen
bei Stettin hineingeboren. Früh wird er gefördert, weil man seine
vielseitigen Talente erkennt. Er überwirft sich aber auch gerne mit
seinen Geld- und Arbeitgebern. Den Schulbesuch bricht er ab. In Jena
studiert er Philosophie bei dem Kantianer Carl Leonhard Reinhold. Doch
im Sog der zahlreichen deutschen Bildungsreisenden zieht es ihn nach
Italien. Den Weg über die Alpen legt er, wie sein Freund und Gefährte
Johann Gottfried Seume seinen «Spaziergang nach Syrakus», zu Fuss
zurück. Wie später Hölderlin, dann auch Friedrich Hebbel wird er einer
der grossen Fusswanderer seiner Zeit. Die Unruhe bis zur Rastlosigkeit,
das Vagierende, das die sinnliche Erfahrung als bestimmendes Erlebnis
und Lebensform sucht und die Bewegung des Denkens mit den Bewegungen des
Körpers verbindet, ist für Carl Ludwig Fernow charakteristisch wie für
diese ganze Epoche von hochgebildeten Nomaden.
- Carl Ludwig Fernow: «Rom ist eine Welt in sich». Briefe 1789-1808. 2 Bände. Herausgegeben und kommentiert von Margrit Glaser und Harald Tausch. Wallstein, Göttingen 2013. 1304 S., Fr. 128.-.
Während seines Aufenthaltes in
Rom, 1794 bis 1803, bildet er sich zum konkurrenzlos kenntnisreichen
Kunstkritiker und Anwalt ästhetischer Theorie. 1803 kehrt er für die
Übernahme einer Professur für Ästhetik nach Jena zurück. Sein
berufliches Leben mündet 1804 in die Übernahme der Stelle eines
Hofbibliothekars der Herzogin Anna Amalia in Weimar. Unter Fernows
Werken ragen seine «Römischen Studien» (drei Teile, Zürich 1806-08),
eine Gesamtausgabe der Werke Winckelmanns (zwei Bände, Dresden 1808),
das «Leben des Künstlers Asmus Jakob Carstens» (Leipzig 1806) und die
Beiträge zur italienischen Sprachlehre, eine Biografie Ariosts sowie die
Herausgabe einer Bibliothek italienischer Klassiker heraus.
Fernow war ein ausserordentlich
geradliniger Charakter. Unter den Fürstenknechten Weimars fand man ihn
nicht. Der Enzyklopädist Johann Gottfried Gruber rühmte seine freie
Seele: «Überall war er männlich und gerade, und behauptete stets jene
unerschütterliche Ruhe, welche nur das Eigentum kräftiger Seelen ist.»
Sein eigener Freiheitssinn hat ihn befähigt, das Organ für die Freiheit
anderer zu entwickeln.
Dieser Zusammenhang zeigt sich
eindrucksvoll in der Rolle, die er für die Familie Schopenhauer spielt.
Als Johanna Schopenhauer, die Mutter, zusammen mit ihrer Tochter Adele
1806 nach Weimar übersiedelt, der Sohn aber gemäss dem Versprechen, das
er seinem Vater gegeben hatte, in Hamburg in Kaufmannsdiensten
zurückzubleiben gezwungen ist, wird Fernow 1807 Arthurs geistiger
Geburtshelfer. Er befreit ihn von der Mesalliance mit dem aufgenötigten
Kaufmannsberuf. Er ermuntert ihn, einen neuen Lebensweg zu beginnen.
Dafür ist es nie zu spät, lautet wie einst für Fernows eigene berufliche
Entwicklung die frohe Botschaft. Fernow nimmt Arthur freilich auch für
ein fleissiges Engagement in den klassischen Studien in die Pflicht. Die
Freiheit, für die er so energisch plädiert, muss erst einmal verdient
werden.
Schopenhauers Zeugnis
In keinem geringeren Zeugnis als
dem Lebenslauf für die Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin hat
Arthur Schopenhauer seines Freiheitslehrers gedacht: «Endlich, (. . .)
als ich, von unerträglichen Gemütsleiden gequält, in den Briefen an
meine bereits in Weimar wohnende Mutter mich in jämmerlichen Klagen über
den vereitelten Lebenszweck erging, über den unersetzlichen Verlust der
auf nichtige Arbeit vergebens verwendeten Kräfte und Jugend, endlich
über mein vorgeschrittenes Lebensalter, das mir nicht mehr verstatte,
die gewählte Laufbahn zu verlassen und eine neue zu beginnen - da
geschah es, dass der berühmte Fernow, ein Mann von wirklich
ausgezeichneten Geistesgaben und meiner Mutter damals eng befreundet, (.
. .) obwohl ich ihm übrigens unbekannt war, bewogen ward, sich mir
gegenüber schriftlich zu äussern, indem er mir klarmachte, dass die bis
dahin verlorene Zeit noch ersetzbar sei, dies durch sein eigenes
Beispiel sowie dasjenige Anderer, selbst der bedeutendsten Gelehrten,
welche erst spät die gelehrte Laufbahn angetreten hätten, bewies, und
mir riet, Alles im Stich zu lassen, um mich auf die Erlernung der alten
Sprachen zu werfen. Als ich diesen Brief gelesen, brach ich in heftiges
Weinen aus, und auf der Stelle stand in mir, dem sonst jede Wahl Qual
machte, der Entschluss fest.»
Das Erstaunliche geschieht: Die
Schopenhauers sind in Bezug auf den Rat und Zuspruch Fernows
ausnahmsweise einmal einer Meinung. Johanna Schopenhauer widmet ihm 1810
ihr Erstlingswerk, eine zweiteilige Beschreibung von «Carl Ludwig
Fernow's Leben». Und Arthur Schopenhauer bringt seinem Freund und
Förderer eine lebenslange Dankbarkeit entgegen. Durch ihn hat er
erfahren, dass man gegen die vorgegebenen Zwänge die Freiheit der
Selbstbestimmung gewinnen kann.



.jpg)
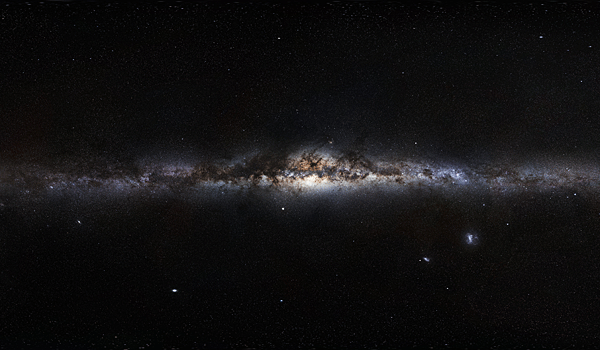



.jpg)

