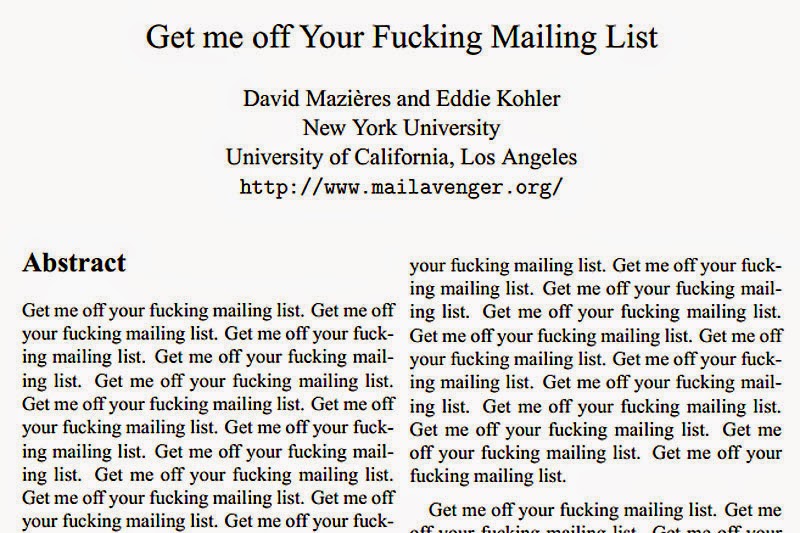aus Die Presse, Wien, 15. 11. 2014
aus Die Presse, Wien, 15. 11. 2014
Wo bleibt die dunkle Materie?
Nur fünf Prozent des Universums seien sichtbar, sagt die Kosmologie, der Rest sei dunkle Energie und dunkle Materie. Jene ist extrem seltsam, aber auch diese lässt rätseln.
von Thomas Kramar
"There's no dark side of the moon really, as a matter of fact it's all dark." Mit diesen gemurmelten Worten endet das berühmte Pink-Floyd-Album „Dark Side Of The Moon“ aus dem Jahr 1973; wenn man grob rundet, könnte man sie als Kurzfassung des Weltbilds sehen, das die Kosmologie uns im Jahr 2014 bietet. Diesem zufolge ist zwar nicht alles dunkel im Universum, aber immerhin 95,1 Prozent von dessen Energie respektive Masse, was, wie uns Einstein gelehrt hat, aufs Selbe hinausläuft.
Das heißt: Nur 4,9 Prozent des Universums sind für uns sichtbar, bestehen also im Wesentlichen aus Atomen. Der Rest ist dunkel: 26,8 Prozent dunkle Materie, 68,3 Prozent dunkle Energie. Diese Aufteilung bescherte uns das Planck-Weltraumteleskop, das 2012 die kosmische Hintergrundstrahlung maß. Davor galten die Daten der Raumsonde WMAP, sie ergaben 72 Prozent dunkle Energie und 23 Prozent dunkle Materie.
Was die dunkle Energie sein soll, darüber sind sich die Physiker weder im Klaren noch einig. Klar ist nur, wozu sie dienen soll: Sie soll erklären, wieso sich das Universum nicht nur ausdehnt, sondern auch immer schneller ausdehnt. Dass es das tut, glauben die Kosmologen seit 1998, sie schlossen es aus Messungen an Supernovas. Im selben Jahr erfand der Astrophysiker Michael Turner den Begriff dunkle Energie. Am ehesten kann man sie sich als Feld vorstellen, das den Raum gleichmäßig erfüllt, nur mit sehr seltsamen Eigenschaften.
Defizit in der Milchstraße.
Die dunkle Materie ist nicht nur etwas fassbarer, sondern auch schon länger im Munde der Physiker: seit 1932. Der niederländische Astronom Jan Hendrik Oort prägte den Begriff. Er fand heraus, dass die Sonne nicht im Zentrum der Milchstraße sitzt (sondern in deren Außenbezirken) und – wie alle Sterne der Milchstraße – um dieses Zentrum rotiert. Zusammengehalten wird die Milchstraße, wie alle größeren Gebilde im All, durch die Schwerkraft, also durch die Anziehungskraft, die ihre Sterne (und sonstige Bewohner) aufeinander ausüben. Doch, so Oort, die Massen der bekannten Sterne in der Scheibe der Milchstraße reichen nicht aus, um zu erklären, warum diese so dünn ist.
Ähnliches befand der Schweizer Physiker Fritz Zwicky 1933 über ein wesentlich größeres und ferneres Objekt: den Comahaufen, der aus über hundert Galaxien besteht. Auch er hat nicht genug sichtbare Masse, um zu erklären, dass er zusammenhält.
Da wird man halt einige Sterne übersehen haben, wird sich so mancher Leser denken. Und das ist auch schon die handgreiflichste Erklärung für die dunkle Materie: Sie sei nicht grundsätzlich unsichtbar, sie bestehe aus ganz normalen Teilchen, denen die elektromagnetische Wechselwirkung nicht fremd ist; man sehe die entsprechenden Objekte schlicht und einfach nicht, weil sie nicht leuchten und auch nicht genug beleuchtet werden.
Die Astronomen denken da etwa an Braune Zwerge, das sind Sterne, die zu klein sind, um je mit der Wasserstofffusion zu beginnen, die also auch nicht leuchten. Im Allgemeinen nennt man solche Objekte Machos, das ist ein Akronym für „massive astrophysical compact halo objects“, Halo steht für den kugelförmigen Teil von Galaxien.
Die Suche nach diesen Machos verlief enttäuschend, heute glaubt man nicht mehr, dass sie ins Gewicht fallen, wenn's um die dunkle Materie geht. Das Gegenteil eines Macho nennt man auf Englisch einen Wimp, einen Schwächling, und die Physiker haben ein entsprechendes Akronym: Sie kürzen „weakly interacting massive particles“ mit Wimps ab. Diese – bisher hypothetischen – Teilchen sollen einem bekannten, aber ziemlich geisterhaften Teilchen, dem Neutrino, insofern ähneln, als sie wie dieses nur die schwache Kernkraft und die Gravitation spüren, aber nicht die anderen beiden Grundkräfte der Physik: starke Kernkraft und Elektromagnetismus.
Supersymmetrie.
Es gibt eine beliebte, weil elegante Theorie, die solche Wimps bescheren könnte: die Supersymmetrie. Nach dieser Theorie gibt es zu jedem bekannten Elementarteilchen ein Pendant, das sich von diesem im Spin wesentlich unterscheidet. Zum Beispiel zum Neutrino ein Neutralino, zu den Quarks sogenannte Squarks, zum Elektron ein Selektron, zum Photon ein Photino. Damit würde sich der Zoo der Elementarteilchen verdoppeln. Allerdings weiß man nicht, welche Massen diese supersymmetrischen Teilchen haben sollen, und man hat bisher in allen Teilchenbeschleunigern keine Spur von ihnen gefunden.
Und auch nicht bei anderen Experimenten, die darauf beruhen, dass solche Wimps – wie die Neutrinos – zwar nur selten und schwach mit anderen Teilchen in Wechselwirkung treten, aber eben doch manchmal. Ein solches Experiment läuft etwa in den Black Hills von Dakota, ungefähr eine Meile unter dem Erdboden, im Large Underground Xenon Experiment, lichtvoll als Lux abgekürzt. Dort warten 350 Kilo flüssiges Xenon unter strenger Beobachtung darauf, dass ein Wimp daherkommt und mit einem Xenon-Atomkern in Wechselwirkung tritt.
Bisher vergeblich. „Es ist ein signifikanter Fehlschlag“, bekannten die Lux-Forscher vor einem Jahr: „Wir sollten schon tausende Ereignisse gesehen haben, aber wir sehen einfach keines.“ Sie widersprachen damit Berichten von ähnlichen Experimenten, man hätte vielleicht ein Wimp-Ereignis beobachtet, und sie schlossen dezidiert aus, dass Wimps, die leichter sind als zehn Protonen, in Dakota aufgetaucht sind.
Was auch Theoretikern zu denken gibt. „Wir suchen jetzt schon ganz schön lang nach Wimps“, sagt Yonit Hochberg vom Berkeley Laboratory, „aber wir haben noch keine gefunden. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, outside the boxzu denken.“ Das tat er. Ihm schweben Teilchen vor, die miteinander sehr stark wechselwirken – und auch mit den bekannten Teilchen, wenn auch nur sehr schwach (Physical Review Letters 113, 171301). Er nennt sie Simps, für „strongly interacting massive particles“. Sie hätten eine skurrile Eigenschaft – wenn drei Simps zusammenstoßen, kommen zwei Simps heraus – und eine den Kosmologen sehr willkommene: Sie würden eine Verteilung von Galaxien ergeben, die der beobachteten Verteilung entspricht.
Neutrinos sind zu heiß.
Nicht zuletzt das erwartet man sich ja von der dunklen Materie: Sie soll erklären, warum sich die heutigen Strukturen im Universum so gebildet haben, wie sie es getan haben: Bottom-up nämlich, erst Sterne, dann Galaxien, dann Galaxienhaufen. Das war auch das wesentliche Argument dafür, dass die – eigentlich als Kandidaten naheliegenden – Neutrinos heute nicht als Hauptbestandteil der dunklen Materie infrage kommen: Sie sind zu schnell, zu leicht, zu heiß, sie würden ein Top-down-Szenario der Strukturbildung bringen.
Diesen Nachteil kann offenbar ein unübersehbarer Vorteil nicht aufwiegen: Man kennt sie, man kann sie beobachten, messen. Das kann man von anderen Kandidaten – zu nennen wären noch weitere hypothetische Teilchen wie Axionen – nicht sagen. So bleibt, ganz abgesehen von der noch rätselhafteren dunklen Energie, ein Großteil der Materie im All vorderhand dunkel. Was für ein seltsames Weltbild.


.jpg)